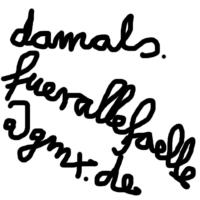Mittwoch, 3. August 2011
Dietrich Bonhoeffer ist lieber gestorben
damals, 20:47h
Im folgenden Text werde ich leise Kritik an der konspirativen Tätigkeit Dietrich Bonhoeffers in der Anti-Hitler-Verschwörung von Canaris üben. Bitte verstehen Sie das nicht falsch. Ich will damit keineswegs andeuten, dass er persönlich falsch gehandelt hätte – im Gegenteil: Bonhoeffer hat ein Leben von beeindruckender Logik, Konsequenz und Verantwortlichkeit geführt, geradlinig bis in den Tod. Daran kann kein Zweifel sein. Falsch finde ich aber, dass sich das Interesse an Märtyrerfiguren wie ihm so auf ihren Tod fokussiert, weniger auf ihre Ideen. So wie man bei Che Guevara besonders gern das „bolivianische Tagebuch“ liest, sich am letzten Trotz-Kampf ergötzt, als die Idee schon gescheitert war – und dieser Idee so die Leuchtkraft, die konkrete Relevanz für das eigene Leben raubt. Bei Bonhoeffer sind es dann die Gefängnisbriefe und das „Von guten Mächten ...“, die Theologie aus der Todeszelle, als hätte die uns Lebenden mehr zu sagen als die konkrete und lebbare Reform des evangelischen Glaubens, die Bonhoeffer in den dreißiger Jahren entwickelte.
Dazu passt, dass Bonhoeffer so eine Art Heiligenleben geführt hat und auch führen wollte. Er hat selbst erkannt, wie viel Eitelkeit in diesem Wunsch steckt und konnte doch nicht davon lassen. Die Banalität und Lächerlichkeit des normalen Lebens in einer Zweier-Beziehung hat er sich gespart und seine faszinierende Idee von einem erneuerten christlichen Glauben so von den Niederungen des Alltags getrennt. Schade.
Doch jetzt mal im Einzelnen: Dietrich Bonhoeffer wurde als später Sohn in ein kinderreiches, großbürgerlich-intellektuelles, sehr liberales Elternhaus hineingeboren. Damit war einerseits schonmal klar, dass er es zu etwas bringen würde im Leben, anderseits aber auch, dass er sich gegen seine älteren Brüder (und auch anders als seine meisten Schwestern) entwickeln würde: nicht die rationale Welt des Vaters, sondern die Religiosität seiner Mutter, einer Hofpredigerstochter, bestimmte die Zielrichtung. Er studierte Theologie und machte rasant Karriere im Uni-Milieu. Dabei kennzeichneten ihn aber nicht nur sein Ehrgeiz, sondern auch sein Charme und seine Jugend, vor allem aber seine unter Theologen ganz unübliche Liberalität. So hatte er z.B. (noch unüblicher!) eine ihm intellektuell ebenbürtige Freundin, die ebenfalls promovierte Theologin Edith Zinn.
Das einzige Problem war, dass er mit Anfang zwanzig noch zu jung war, um die sichere Professorenstelle an der Berliner Uni schon anzutreten. Man schickte ihn daher ein Jahr nach Amerika, wo er, der erfolgreiche Theologe, erstmals mit wirklich gelebtem Glauben in Kontakt kam: in den Gemeinden der Schwarzen in Harlem. Das krempelte sein Leben um, sein Fokus wechselte von der Wissenschaft zur Praxis des Glaubens, er begann, sich mit Meditation zu beschäftigen, plante eine Reise zu Mahatma Gandhi, entwickelte eine verblüffend einfache, faszinierende Idee, wie evangelischer Glauben wieder echt werden könnte: indem man nämlich die Wiedergeburt Christi als eine Wiedergeburt in der Gemeinde versteht, d.h. die Gemeinde selbst ist Christus. Und das bedeutet wiederum, dass Christ zu sein nichts anderes heißt als erstens gemeinschaftlich und zweitens wie Christus zu leben.
Leider kam Bonhoeffer das Jahr 1933 dazwischen und zerstörte seine ersten Schritte heraus aus dem goldenen Käfig: Die Jugendstube für Arbeitslose, die er 1932 in Berlin-Charlottenburg gründete, löste die SA auf, einige seiner Bekannten von dort musste er sogar in einer Gartenlaube verstecken, da sie als des Kommunismus verdächtig in Lebensgefahr waren. Den Plan, eine Pfarrstelle im Berliner Osten anzutreten, konnte er sich unter diesen Umständen natürlich abschminken.
Stattdessen tat sich ein neues Tätigkeitsfeld auf: Hitlers Versuche, die evangelischen Kirche gleichzuschalten, führten zur Konstitution der Bekennenden Kirche. Bonhoeffer nutzt die Situation, indem er diese heterogene Protestbewegung sammelt und zu einer Abspaltung von der rettungslos opportunistischen Staatskirche zu bewegen versucht. Er hofft, mit diesen Leuten seine Ideen von einer erneuerten Glaubensgemeinschaft realisieren zu können und übernimmt die Leitung eines Priesterseminars für die Bekenntnisbewegung. Fortan pendelt er zwischen Berlin, wo er an der Uni lehrt und bei den Eltern wohnt, und Finkenwalde bei Stettin, wo er im Seminar seine Praxis- und Gemeinschaftssehnsüchte lebt.
Ende 1935 werden die Seminare der Bekennenden Kirche dann offiziell verboten. Bonhoeffer muss sich aus der Bürgerlichkeit (die für ihn Berlin heißt) lösen. Er verliert den Job an der Uni und trennt sich von seiner Freundin, will nur noch für Finkenwalde leben. Schließlich haben seine Seminaristen auch keine Chance auf ein solches bürgerliches Leben: Sie werden später, wenn überhaupt, nur als schlecht bezahlte „Hilfsprediger“ eine Stelle finden. Aber so wie sie nicht ins bürgerliche Leben hinein finden, so findet Bonhoeffer nicht heraus: Er pendelt weiter zwischen Berlin und Finkenwalde. Nur die Uni ist endgültig verloren – und natürlich Edith Zinn.
Bonhoeffer schafft sich als Ersatz für die geplante offizielle Verbindung (ob nun Verlobung oder schon Hochzeit, darüber schweigen sich die Biografen aus) einen Mini-Männerbund in Finkenwalde, dessen Kern er und sein bester Freund Eberhard Bethge darstellen. Dieser „Bruderrat“ soll mit den wechselnden Seminaristen eine Kontinuität des Lebens im Glauben einüben, ganz nach den zuvor von Bonhoeffer entwickelten Ideen über die christliche Gemeinde.
Natürlich hat dieses Projekt eine gewisse Künstlichkeit, schon allein wegen des völligen Fehlens von Frauen, aber natürlich auch in seiner Isoliertheit von der gesellschaftlichen Realität im Lande. Während in Finkenwalde ein Handvoll junger Männer ein unabhängiges Christentum lebt, dreht die nazifizierte Kirchenleitung in mühevoller Kleinarbeit, aber äußerst erfolgreich ein Leitungsmitglied der Bekennenden Kirche nach dem anderen um und integriert es in die gleichgeschaltete Staatskirche. Gleichzeitig laufen die bekannten Diskriminierungsaktionen gegen die Juden und die immer offene Vorbereitung des Krieges.
Bonhoeffer, der auf keinen Fall in den näher rückenden Krieg ziehen will, gibt auf und plant seine Emigration in die USA, die er vor sich selbst als Studienreise mit diffusem Ziel tarnt. Erst in New York begreift er, dass er bereits emigriert ist, dass er seine Familie in Berlin und seine Zweitfamilie in Finkenwalde auf Jahre nicht wiedersehen wird. Das hält er nicht aus und kehrt um. Es ist der Sommer 1939.
Zurück in Deutschland fährt er erstmal mit seinem Seminar an die Ostsee baden. Dann kommt mit dem Angriff auf Polen der Krieg. Finkenwalde liegt direkt im Kampfgebiet, das Semester kann nicht beginnen. Kurz darauf versiegelt die Gestapo das Haus in Finkenwalde. Die ersten Seminaristen werden eingezogen. Das Projekt ist gestorben.
Aber für den Chef ergibt sich eine neue Perspektive. Sein Schwager, Hans von Dohnanyi, arbeitet für den Geheimdienst der Wehrmacht und wirbt ihn als Agenten, zunächst um ihn vor einer möglichen Einberufung zu retten. Bonhoeffer weiß zu diesem Zeitpunkt schon, dass der Dienst im Geheimen gegen Hitler konspiriert, sein Schwager ist der Kern der Verschwörung. Natürlich tut er bei dieser Aktion mit, so gut er kann. So wie der Bruderrat ein Ersatz für die Ehe war, so ist die Verschwörung der Ersatz für den Bruderrat. Am Ende stehen die Verhaftung im Jahr 1943 und der Tod als Märtyrer.
Also, ich finde, das war einfach nicht Bonhoeffers Sache, diese Verschwörung, das war die Sache seiner Schwager und ihrer Kollegen – die nämlich, anders als der bekennende Pfarrer, in verantwortlichen Stellen des Staates saßen und ihrer Verantwortung weiter nachkamen, als die Politik ihres Staates ins Unverantwortliche abglitt. Natürlich ist es ehrenhaft, was Bonhoeffer getan hat, als er unter Einsatz seines Lebens dieses Projekt unterstützte – nur seiner Idee, der Idee eines gelebten Christseins, lief sie eigentlich zuwider, wie schon, wenn man ganz ehrlich ist, das Projekt seines privaten Finkenwalder Bruderrates.
Dass da irgendwas verkehrt gelaufen ist, das erweist sich meines Erachtens am Beziehungsproblem: Von seiner wirklichen Partnerin trennt er sich aus altmodischen bürgerlichen Rücksichten (die sie nicht einmal geteilt hätte – wie Renate Wind recherchiert hat) à la „Ich kann ihr keine Sicherheit bieten.“ Stattdessen verbindet er sich Jahre später als über 40-Jähriger aufs Konservativste (vorherige Absprache mit der Brautmutter) mit der 18-jährigen Tochter eines Bekannten.
Nein, die Flucht in die spätpubertäre Männergemeinschaft in Finkenwalde kann ebenso wenig eine wirkliche christliche Gemeinschaft ersetzen wie die Flucht ins Politikspiel der erwachsenen Männergesellschaft. Bonhoeffer hätte heiraten sollen, und zwar seine ebenbürtige Partnerin. Ohne die Ambivalenz geschlechtlicher Beziehung (wie auch immer diese organisiert sein mag) ist das doch alles nichts wert.
Dazu passt, dass Bonhoeffer so eine Art Heiligenleben geführt hat und auch führen wollte. Er hat selbst erkannt, wie viel Eitelkeit in diesem Wunsch steckt und konnte doch nicht davon lassen. Die Banalität und Lächerlichkeit des normalen Lebens in einer Zweier-Beziehung hat er sich gespart und seine faszinierende Idee von einem erneuerten christlichen Glauben so von den Niederungen des Alltags getrennt. Schade.
Doch jetzt mal im Einzelnen: Dietrich Bonhoeffer wurde als später Sohn in ein kinderreiches, großbürgerlich-intellektuelles, sehr liberales Elternhaus hineingeboren. Damit war einerseits schonmal klar, dass er es zu etwas bringen würde im Leben, anderseits aber auch, dass er sich gegen seine älteren Brüder (und auch anders als seine meisten Schwestern) entwickeln würde: nicht die rationale Welt des Vaters, sondern die Religiosität seiner Mutter, einer Hofpredigerstochter, bestimmte die Zielrichtung. Er studierte Theologie und machte rasant Karriere im Uni-Milieu. Dabei kennzeichneten ihn aber nicht nur sein Ehrgeiz, sondern auch sein Charme und seine Jugend, vor allem aber seine unter Theologen ganz unübliche Liberalität. So hatte er z.B. (noch unüblicher!) eine ihm intellektuell ebenbürtige Freundin, die ebenfalls promovierte Theologin Edith Zinn.
Das einzige Problem war, dass er mit Anfang zwanzig noch zu jung war, um die sichere Professorenstelle an der Berliner Uni schon anzutreten. Man schickte ihn daher ein Jahr nach Amerika, wo er, der erfolgreiche Theologe, erstmals mit wirklich gelebtem Glauben in Kontakt kam: in den Gemeinden der Schwarzen in Harlem. Das krempelte sein Leben um, sein Fokus wechselte von der Wissenschaft zur Praxis des Glaubens, er begann, sich mit Meditation zu beschäftigen, plante eine Reise zu Mahatma Gandhi, entwickelte eine verblüffend einfache, faszinierende Idee, wie evangelischer Glauben wieder echt werden könnte: indem man nämlich die Wiedergeburt Christi als eine Wiedergeburt in der Gemeinde versteht, d.h. die Gemeinde selbst ist Christus. Und das bedeutet wiederum, dass Christ zu sein nichts anderes heißt als erstens gemeinschaftlich und zweitens wie Christus zu leben.
Leider kam Bonhoeffer das Jahr 1933 dazwischen und zerstörte seine ersten Schritte heraus aus dem goldenen Käfig: Die Jugendstube für Arbeitslose, die er 1932 in Berlin-Charlottenburg gründete, löste die SA auf, einige seiner Bekannten von dort musste er sogar in einer Gartenlaube verstecken, da sie als des Kommunismus verdächtig in Lebensgefahr waren. Den Plan, eine Pfarrstelle im Berliner Osten anzutreten, konnte er sich unter diesen Umständen natürlich abschminken.
Stattdessen tat sich ein neues Tätigkeitsfeld auf: Hitlers Versuche, die evangelischen Kirche gleichzuschalten, führten zur Konstitution der Bekennenden Kirche. Bonhoeffer nutzt die Situation, indem er diese heterogene Protestbewegung sammelt und zu einer Abspaltung von der rettungslos opportunistischen Staatskirche zu bewegen versucht. Er hofft, mit diesen Leuten seine Ideen von einer erneuerten Glaubensgemeinschaft realisieren zu können und übernimmt die Leitung eines Priesterseminars für die Bekenntnisbewegung. Fortan pendelt er zwischen Berlin, wo er an der Uni lehrt und bei den Eltern wohnt, und Finkenwalde bei Stettin, wo er im Seminar seine Praxis- und Gemeinschaftssehnsüchte lebt.
Ende 1935 werden die Seminare der Bekennenden Kirche dann offiziell verboten. Bonhoeffer muss sich aus der Bürgerlichkeit (die für ihn Berlin heißt) lösen. Er verliert den Job an der Uni und trennt sich von seiner Freundin, will nur noch für Finkenwalde leben. Schließlich haben seine Seminaristen auch keine Chance auf ein solches bürgerliches Leben: Sie werden später, wenn überhaupt, nur als schlecht bezahlte „Hilfsprediger“ eine Stelle finden. Aber so wie sie nicht ins bürgerliche Leben hinein finden, so findet Bonhoeffer nicht heraus: Er pendelt weiter zwischen Berlin und Finkenwalde. Nur die Uni ist endgültig verloren – und natürlich Edith Zinn.
Bonhoeffer schafft sich als Ersatz für die geplante offizielle Verbindung (ob nun Verlobung oder schon Hochzeit, darüber schweigen sich die Biografen aus) einen Mini-Männerbund in Finkenwalde, dessen Kern er und sein bester Freund Eberhard Bethge darstellen. Dieser „Bruderrat“ soll mit den wechselnden Seminaristen eine Kontinuität des Lebens im Glauben einüben, ganz nach den zuvor von Bonhoeffer entwickelten Ideen über die christliche Gemeinde.
Natürlich hat dieses Projekt eine gewisse Künstlichkeit, schon allein wegen des völligen Fehlens von Frauen, aber natürlich auch in seiner Isoliertheit von der gesellschaftlichen Realität im Lande. Während in Finkenwalde ein Handvoll junger Männer ein unabhängiges Christentum lebt, dreht die nazifizierte Kirchenleitung in mühevoller Kleinarbeit, aber äußerst erfolgreich ein Leitungsmitglied der Bekennenden Kirche nach dem anderen um und integriert es in die gleichgeschaltete Staatskirche. Gleichzeitig laufen die bekannten Diskriminierungsaktionen gegen die Juden und die immer offene Vorbereitung des Krieges.
Bonhoeffer, der auf keinen Fall in den näher rückenden Krieg ziehen will, gibt auf und plant seine Emigration in die USA, die er vor sich selbst als Studienreise mit diffusem Ziel tarnt. Erst in New York begreift er, dass er bereits emigriert ist, dass er seine Familie in Berlin und seine Zweitfamilie in Finkenwalde auf Jahre nicht wiedersehen wird. Das hält er nicht aus und kehrt um. Es ist der Sommer 1939.
Zurück in Deutschland fährt er erstmal mit seinem Seminar an die Ostsee baden. Dann kommt mit dem Angriff auf Polen der Krieg. Finkenwalde liegt direkt im Kampfgebiet, das Semester kann nicht beginnen. Kurz darauf versiegelt die Gestapo das Haus in Finkenwalde. Die ersten Seminaristen werden eingezogen. Das Projekt ist gestorben.
Aber für den Chef ergibt sich eine neue Perspektive. Sein Schwager, Hans von Dohnanyi, arbeitet für den Geheimdienst der Wehrmacht und wirbt ihn als Agenten, zunächst um ihn vor einer möglichen Einberufung zu retten. Bonhoeffer weiß zu diesem Zeitpunkt schon, dass der Dienst im Geheimen gegen Hitler konspiriert, sein Schwager ist der Kern der Verschwörung. Natürlich tut er bei dieser Aktion mit, so gut er kann. So wie der Bruderrat ein Ersatz für die Ehe war, so ist die Verschwörung der Ersatz für den Bruderrat. Am Ende stehen die Verhaftung im Jahr 1943 und der Tod als Märtyrer.
Also, ich finde, das war einfach nicht Bonhoeffers Sache, diese Verschwörung, das war die Sache seiner Schwager und ihrer Kollegen – die nämlich, anders als der bekennende Pfarrer, in verantwortlichen Stellen des Staates saßen und ihrer Verantwortung weiter nachkamen, als die Politik ihres Staates ins Unverantwortliche abglitt. Natürlich ist es ehrenhaft, was Bonhoeffer getan hat, als er unter Einsatz seines Lebens dieses Projekt unterstützte – nur seiner Idee, der Idee eines gelebten Christseins, lief sie eigentlich zuwider, wie schon, wenn man ganz ehrlich ist, das Projekt seines privaten Finkenwalder Bruderrates.
Dass da irgendwas verkehrt gelaufen ist, das erweist sich meines Erachtens am Beziehungsproblem: Von seiner wirklichen Partnerin trennt er sich aus altmodischen bürgerlichen Rücksichten (die sie nicht einmal geteilt hätte – wie Renate Wind recherchiert hat) à la „Ich kann ihr keine Sicherheit bieten.“ Stattdessen verbindet er sich Jahre später als über 40-Jähriger aufs Konservativste (vorherige Absprache mit der Brautmutter) mit der 18-jährigen Tochter eines Bekannten.
Nein, die Flucht in die spätpubertäre Männergemeinschaft in Finkenwalde kann ebenso wenig eine wirkliche christliche Gemeinschaft ersetzen wie die Flucht ins Politikspiel der erwachsenen Männergesellschaft. Bonhoeffer hätte heiraten sollen, und zwar seine ebenbürtige Partnerin. Ohne die Ambivalenz geschlechtlicher Beziehung (wie auch immer diese organisiert sein mag) ist das doch alles nichts wert.
... link (1 Kommentar) ... comment
Sonntag, 19. Juni 2011
Wann ist eine dokumentarische Collage authentisch?
damals, 14:07h
In der Neuen Zürcher Zeitung von gestern (18.6.) erklärt Pepe Danquart seine künstlerische Haltung. Auf die Kritik, sein Joschka-Fischer-Film lasse eine kritische Distanz vermissen, meint er, „das sei keine Biografie, schon gar keine journalistisch aufbereitete, sondern ein Stück Zeitgeschichte, mit einem charismatischen Erzähler.“ Ein interessantes Argumentationsmuster, besonders für einen Linken.
Ein Dokumentarfilm darf also auf kritische Distanz verzichten, ja, er muss es sogar, wenn er zum Kern der Sache, der „Zeitgeschichte“, vordringen will. Wenn der Regisseur des Films seinen eigenen Kopf verwendet, dann ist das „journalistische Aufbereitung“, eine künstliche Zugabe, die den Blick auf das Wesentliche verstellt. Echtheit garantiert der „charismatische Erzähler“, der damals dabei gewesen ist. Dessen Sicht der Dinge darf der Regisseur blind folgen; sie ist akzeptabel, weil sie charismatisch ist – mit anderen Worten: weil sie funktioniert.
Diese Haltung hat aber, so finde ich, zur notwendigen Folge, dass die Wahrheit des Films eine Spielfilm-Wahrheit, eine fiktionale Wahrheit, ist. Das ist an sich nichts Verkehrtes. Nur: Eine subjektive Erzählung als „Zeitgeschichte“ zu verkaufen – das finde ich unehrlich.
Wie aber anders? Dafür habe ich kürzlich im Fernsehen ein großartiges Beispiel gesehen: „Heinz und Fred“, einen Film über ein merkwürdiges Vater-Sohn-Verhältnis auf dem Lande in Thüringen. Auch dieser Film wurde im Fernsehen als Dokumentarfilm annonciert – er begann aber damit, dass die ersten dokumentarischen Bilder mit einem Off-Erzähler unterlegt wurden, der – in tiefsten Thüringisch – eine märchenhafte Einleitung sprach und damit alles Folgende deutlich als Märchen kennzeichnete. Auch später strukturierte dieser Märchen-Erzähler die Geschichte. Der Zuschauer wusste Bescheid, dass die Handlung vom Regisseur ausgedacht, wenn auch aus echtem Dokumentarmaterial montiert worden war. Und daher war ich gar nicht böse, als ich merkte, dass dieser offenbar ganze Lebensbereiche aus dem Familienportrait ausgespart (oder erst an dramaturgisch effektvoller Stelle eingesetzt) hat, dass er Szenen chronologisch umgestellt, dass er aus seinem Material eine Geschichte gebastelt hat, so wie das heutzutage alle – von Guido Knopp bis Heinrich Breloer – so tun in ihren unsäglichen Dokumentarspielen. Nur: Er ist von Anfang an als Interpret präsent, er bietet uns seine Sicht der Dinge an – und das ist ein ehrliches Angebot. Das kann ich annehmen, diese Montage ist echt.
Ein Dokumentarfilm darf also auf kritische Distanz verzichten, ja, er muss es sogar, wenn er zum Kern der Sache, der „Zeitgeschichte“, vordringen will. Wenn der Regisseur des Films seinen eigenen Kopf verwendet, dann ist das „journalistische Aufbereitung“, eine künstliche Zugabe, die den Blick auf das Wesentliche verstellt. Echtheit garantiert der „charismatische Erzähler“, der damals dabei gewesen ist. Dessen Sicht der Dinge darf der Regisseur blind folgen; sie ist akzeptabel, weil sie charismatisch ist – mit anderen Worten: weil sie funktioniert.
Diese Haltung hat aber, so finde ich, zur notwendigen Folge, dass die Wahrheit des Films eine Spielfilm-Wahrheit, eine fiktionale Wahrheit, ist. Das ist an sich nichts Verkehrtes. Nur: Eine subjektive Erzählung als „Zeitgeschichte“ zu verkaufen – das finde ich unehrlich.
Wie aber anders? Dafür habe ich kürzlich im Fernsehen ein großartiges Beispiel gesehen: „Heinz und Fred“, einen Film über ein merkwürdiges Vater-Sohn-Verhältnis auf dem Lande in Thüringen. Auch dieser Film wurde im Fernsehen als Dokumentarfilm annonciert – er begann aber damit, dass die ersten dokumentarischen Bilder mit einem Off-Erzähler unterlegt wurden, der – in tiefsten Thüringisch – eine märchenhafte Einleitung sprach und damit alles Folgende deutlich als Märchen kennzeichnete. Auch später strukturierte dieser Märchen-Erzähler die Geschichte. Der Zuschauer wusste Bescheid, dass die Handlung vom Regisseur ausgedacht, wenn auch aus echtem Dokumentarmaterial montiert worden war. Und daher war ich gar nicht böse, als ich merkte, dass dieser offenbar ganze Lebensbereiche aus dem Familienportrait ausgespart (oder erst an dramaturgisch effektvoller Stelle eingesetzt) hat, dass er Szenen chronologisch umgestellt, dass er aus seinem Material eine Geschichte gebastelt hat, so wie das heutzutage alle – von Guido Knopp bis Heinrich Breloer – so tun in ihren unsäglichen Dokumentarspielen. Nur: Er ist von Anfang an als Interpret präsent, er bietet uns seine Sicht der Dinge an – und das ist ein ehrliches Angebot. Das kann ich annehmen, diese Montage ist echt.
... link (0 Kommentare) ... comment
Donnerstag, 26. Mai 2011
Aus gegebenem Anlass: Lesetipp Hans Fallada
damals, 22:33h
Beim Aufbau-Verlag ist eine „vollständige“ Ausgabe von „Jeder stirbt für sich allein“ erschienen. Das Beiwort verspricht so eine Art Directors-Cut-Atmosphäre, obwohl ich glaube, dass der Schein trügt. Aber das ist vermutlich noch gar nicht der „gegebene Anlass“. Vielmehr scheint es eine Neu-Übersetzung desselben Romans ins Englische zu sein, die zum Bestseller wurde und so dazu führte, dass man sich auch im deutschen Sprachraum Hans Falladas erinnert. Nun, auf diese Aufmerksamkeitswelle möchte ich aufspringen.
Meine letzte Fallada-Lektüre ist ein paar Jahre her. Auf dem Bücherflohmarkt der örtlichen Gemeinde fiel mir ein Taschenbuch mit kurzen Fallada-Erzählungen in die Hände. Und diese Texte waren großartig: einfach, aber intensiv erzählt, realititätsnah, nachdenklich machend. Ich habe dann die „Geschichten aus der Murkelei“ zu Gute-Nacht-Geschichten für meinen Sohn gemacht mit großem Erfolg und mir auch ein paar Fallada-Romane vorgenommen: zunächst einmal „Kleiner Mann, was nun?“, das ich schonmal als Jugendlicher gelesen hatte, dann „Bauern, Bonzen, Bomben“ (weil das meine Mutter immer empfiehlt) und endlich “Wir hatten mal ein Kind“. So richtig überzeugt hat mich keiner der Romane, so dass Nr. 4 meiner Liste, „Der Trinker“, ungelesen liegen blieb.
Aber alle drei Bücher waren nur so halb gut: In „Wir hatten mal ein Kind“, das ich als Ganzes gesehen etwas sentimental fand, gibt es viele wunderbare Einzelepisoden. In „Kleiner Mann, was nun?“ finde ich den Beginn, die pommersche Kleinstadt-Atmosphäre, sehr gut getroffen. Und in „Bauern, Bonzen, Bomben“ hat mich weniger das historisch sicher interessante Thema (eine Revolte von rechts) berührt (anders als Göbbels, der davon begeistert war), sondern viel mehr das alter ego des Autors, das sich als arme, aufrecht sich bemühende, aber moralisch etwas zweifelhafte Person durchs Leben müht und natürlich genau dort scheitert, wo sie glaubt, das große Los gezogen zu haben. Ab dem Moment, wo sie stirbt, hatte mir das Buch nichts mehr zu sagen.
Also, was ich toll finde an Fallada, das ist sein Grundthema: das Elend des kleinen Mannes, das gar nicht in seiner Armut besteht, sondern in der gemeinen Tatsache, dass seine moralische Standfestigkeit viel leichter in Versuchung gerät als die des saturierten Normalbürgers . Und dieses Thema lässt sich vermutlich viel intensiver in kleinen Skizzen darstellen als in großen Romanen. Lesen Sie mal „Länge der Leidenschaft“ (eine Geschichte über die Liebe einer jungen Frau zu einem Betrüger) oder „Schmuggler und Gendarm“ (über einen vitalen Ganoven und eine arme Wurst von einem Gendarmen).
Oder machen Sie`s wie ich: Lesen Sie eine Fallada-Biografie. Wenn es eine gute ist wie die hier, werden Sie gerührt sein. Falladas Leben hat Romanqualitäten, und er war selbst dieser immer wieder strauchelnde kleine Mann: Er kam von oben (sein Vater war Richter am Reichsgericht), fiel nach ganz unten (Schießerei, Drogen, Betrügereien und Gefängnis), rappelte sich einigermaßen auf (fand eine robuste Frau aus dem Arbeitermilieu und sogar einen wohlwollenden Lektor – Rowohlt), aber blieb zeitlebens versucht vom Bösen (glaubte z.B. , Goebbels überlisten zu können, was natürlich schief ging), konnte von den Drogen nicht lassen (vielleicht auch dadurch erwarb er sich die Verehrung Johannes R. Bechers, der ebenso wie Fallada durch Drogen aus seiner großbürgerlichen Existenz gestürzt war einst und Fallada an seinem Lebensende vor den Karren der sowjetischen Kulturpolitik spannte).
Merkwürdig, dass es nun gerade dieses, vom späteren DDR-Kulturminister Becher in Auftrag gegebene, Buch ist, das nun zum Besteller wird: „Jeder stirbt für sich allein“. Ich werd es nicht nochmal lesen. Fallada hat Wichtigeres zu sagen als getreuliche Nazi-Aufarbeitung. Ich probiere es demnächst mit dem „Trinker“, der schon zum Lesen auf meinem Nachttisch bereit liegt. Und ich werde Ihnen berichten, ob sich meine Hoffnung erfüllt, dass er es nun endlich ist, der lang gesuchte, richtig gute Fallada-Roman.
Meine letzte Fallada-Lektüre ist ein paar Jahre her. Auf dem Bücherflohmarkt der örtlichen Gemeinde fiel mir ein Taschenbuch mit kurzen Fallada-Erzählungen in die Hände. Und diese Texte waren großartig: einfach, aber intensiv erzählt, realititätsnah, nachdenklich machend. Ich habe dann die „Geschichten aus der Murkelei“ zu Gute-Nacht-Geschichten für meinen Sohn gemacht mit großem Erfolg und mir auch ein paar Fallada-Romane vorgenommen: zunächst einmal „Kleiner Mann, was nun?“, das ich schonmal als Jugendlicher gelesen hatte, dann „Bauern, Bonzen, Bomben“ (weil das meine Mutter immer empfiehlt) und endlich “Wir hatten mal ein Kind“. So richtig überzeugt hat mich keiner der Romane, so dass Nr. 4 meiner Liste, „Der Trinker“, ungelesen liegen blieb.
Aber alle drei Bücher waren nur so halb gut: In „Wir hatten mal ein Kind“, das ich als Ganzes gesehen etwas sentimental fand, gibt es viele wunderbare Einzelepisoden. In „Kleiner Mann, was nun?“ finde ich den Beginn, die pommersche Kleinstadt-Atmosphäre, sehr gut getroffen. Und in „Bauern, Bonzen, Bomben“ hat mich weniger das historisch sicher interessante Thema (eine Revolte von rechts) berührt (anders als Göbbels, der davon begeistert war), sondern viel mehr das alter ego des Autors, das sich als arme, aufrecht sich bemühende, aber moralisch etwas zweifelhafte Person durchs Leben müht und natürlich genau dort scheitert, wo sie glaubt, das große Los gezogen zu haben. Ab dem Moment, wo sie stirbt, hatte mir das Buch nichts mehr zu sagen.
Also, was ich toll finde an Fallada, das ist sein Grundthema: das Elend des kleinen Mannes, das gar nicht in seiner Armut besteht, sondern in der gemeinen Tatsache, dass seine moralische Standfestigkeit viel leichter in Versuchung gerät als die des saturierten Normalbürgers . Und dieses Thema lässt sich vermutlich viel intensiver in kleinen Skizzen darstellen als in großen Romanen. Lesen Sie mal „Länge der Leidenschaft“ (eine Geschichte über die Liebe einer jungen Frau zu einem Betrüger) oder „Schmuggler und Gendarm“ (über einen vitalen Ganoven und eine arme Wurst von einem Gendarmen).
Oder machen Sie`s wie ich: Lesen Sie eine Fallada-Biografie. Wenn es eine gute ist wie die hier, werden Sie gerührt sein. Falladas Leben hat Romanqualitäten, und er war selbst dieser immer wieder strauchelnde kleine Mann: Er kam von oben (sein Vater war Richter am Reichsgericht), fiel nach ganz unten (Schießerei, Drogen, Betrügereien und Gefängnis), rappelte sich einigermaßen auf (fand eine robuste Frau aus dem Arbeitermilieu und sogar einen wohlwollenden Lektor – Rowohlt), aber blieb zeitlebens versucht vom Bösen (glaubte z.B. , Goebbels überlisten zu können, was natürlich schief ging), konnte von den Drogen nicht lassen (vielleicht auch dadurch erwarb er sich die Verehrung Johannes R. Bechers, der ebenso wie Fallada durch Drogen aus seiner großbürgerlichen Existenz gestürzt war einst und Fallada an seinem Lebensende vor den Karren der sowjetischen Kulturpolitik spannte).
Merkwürdig, dass es nun gerade dieses, vom späteren DDR-Kulturminister Becher in Auftrag gegebene, Buch ist, das nun zum Besteller wird: „Jeder stirbt für sich allein“. Ich werd es nicht nochmal lesen. Fallada hat Wichtigeres zu sagen als getreuliche Nazi-Aufarbeitung. Ich probiere es demnächst mit dem „Trinker“, der schon zum Lesen auf meinem Nachttisch bereit liegt. Und ich werde Ihnen berichten, ob sich meine Hoffnung erfüllt, dass er es nun endlich ist, der lang gesuchte, richtig gute Fallada-Roman.
... link (1 Kommentar) ... comment
Mittwoch, 16. März 2011
Warum ist das, was schrecklich ist, eigentlich immer besonders spannend? (Rezension meiner aktuellen Lektüren)
damals, 21:49h
Das fragte gestern mein Sohn, der die Frühjahrsferien bei seinen politikbegeisterten Großeltern verbringt und zu jeder Mahlzeit von diesen ehrlich entsetzte Kommentare zur jeweils aktuellen Weltkatastrophe erhält. Ja, warum eigentlich? Warum ist der Freiheitswillen des lybischen Volkes gestern ein Grund, gebannt auf den Fernsehschirm zu starren, aber heute explodiert ein Atomkraftwerk in Japan und Lybien ist vergessen? Meine Eltern würden hier sicher widersprechen, natürlich sind ihre Gedanken „auf Seite 2“ immer noch bei Lybien – und bei den Palästinensern sowieso, wo schon wieder illegale Häuser errichtet werden. Aber das blanke Entsetzen, das immer da ist, das kann immer nur an einem Ort sein, und das ist eben im Moment Japan.
Zum Glück funktioniert Literatur nicht immer so – und damit wäre ich bei der Besprechung meiner derzeitigen Lektüren. Ich hatte mir nämlich letztes Jahr anhand des Feuilletons ein paar Wunschbücher zusammengesucht und mich dann zu Weihnachten beschenken lassen. Da ich derzeit nur abends im Bett ein paar Minuten zum Lesen komme, gehörten der Januar und der Februar vollständig Melinda Nadj Abonjis „Tauben fliegen auf“, dem autobiografisch gefärbten Roman über zwei ungarisch-stämmige Schwestern aus der jugoslawischen Vojvodina, die als Kinder mit ihren Eltern in die Schweiz auswandern, den Jugoslawien-Krieg nur noch von außen, als Entronnene, durch unsichere Nachrichten aus der verlorenen Heimat, mitbekommen. Da geriet ich am Ende tatsächlich wieder in die oben beschriebene Politik-Falle: Ich ließ mich zwar hinreißen vom ungelenk-schwungvollen Charme des balkanesischen Wortschwalls (der Titel „Tauben fliegen auf“ charakterisiert diesen deutlich), war gerührt von der eindringlichen Darstellung, wie es ist, in der Fremde zu leben (wo ja niemand, auch der nicht der coolste Wirtschaftsflüchtling, als der der Vater der Familie sich gern ausgibt, ganz freiwillig ist) ... Ich ließ mich rühren und blieb dennoch unzufrieden, weil man so rein gar nichts erfährt über die Vorgänge in Jugoslawien – und dann auch noch verspottet wird, weil man das wissen will: „und wahrscheinlich würde Herrn Tognoni, Herrn und Frau Berger und die Schärers das, was ich von meinem Land erzählen wollte, nicht interessieren, es wäre gut möglich, dass sie mich etwas verlegen und mitleidig anschauen würden: Fräulein, wir dachten da an etwas Anderes, wir wollten etwas über die Kultur, die Geschichte, die Sprache, die Probleme erfahren – und nicht über die Luft zwischen den majestätischen Pappeln und Akazien, die winzigen Blumen, die zwischen den Pflastersteinen wachsen, ...“ (S. 241). Dabei hätte die Geschichte durchaus Anlass gegeben, gesellschaftlich konkreter zu werden: Der Cousin der Ich-Erzählerin wird zum Kriegsdienst gezwungen und abgeführt - und verschwindet einfach aus der Geschichte. Das ist realistisch, aber lässt den Leser unbefriedigt. Es bleibt eine Leerstelle.
Vielleicht hängt es auch mit dieser Leerstelle zusammen, dass die Erzählerin sich später in einen offenbar traumatisierten Jungen aus Sarajewo verliebt. Aber auch der erzählt nichts. Verständlich, aber unbefriedigend. Was bleibt, ist das hilflose Mitgefühl der Erzählerin, z. B. gegenüber ihrem Vater: „einen Moment lang schaue ich meinem Vater in die schutzlosen Augen, und ich würde gern einen Trost finden, mein Herz würde ihn gern geben, diesen Trost, jetzt, da mein Vater ein hilfloses Kind ist, aber ich, ich bin auch ein hilfloses Kind, seines, wenigstens das würde ich ihm gern sagen, ich stehe auf, verschwinde rasch in Richtung Toilette.“ (S. 163).
Welche Größe in dieser Selbstbescheidung liegt, in diesem Verzicht, die Schrecklichkeiten alle zu benennen, das begriff ich erst, als ich zum nächsten Buch griff: Sofi Oksanen „Fegefeuer“, Thema: eine andere Menschheitskatastrophe am Rande des russischen Imperiums: Estland zwischen den dreißiger Jahren und heute. Hier wird alles deutlich ausgesprochen, überdeutlich sogar. Jedes Verbrechen, jede Gemeinheit. Selbst die Fliege, die auch das Cover des Buches ziert, fliegt in ausführlich beschriebener Scheußlichkeit durch die Küche der Protagonistin und legt ihre Eier in jedes erreichbare Stückchen Fleisch. Diese Erzähltechnik lässt den Leser in Schockstarre verfallen, gebannt das Geschehen verfolgen. Zumal immer irgendetwas passiert – Spannung garantiert. Aber ehrlich gesagt: Historisch Neues erfährt man trotz Überdeutlichkeit nicht – dass erst die Russen die Esten deportierten, dann die Deutschen die Juden, dass erst die Kommunisten die national gesinnten Esten, dann diese wiederum die Kommunisten verfolgten und dass heutzutage mafiöse Organisationen, die sich teilweise auch aus ehemaligen KGB-Leuten rekrutieren, den Menschenhandel von Russinnen zur Prostitution nach Deutschland organisieren, das ist eigentlich schon bekannt. Das Wie hätte mich interessiert. Aber Psychologie ist nicht die Sache der Autorin. Das ärgert mich. Und dennoch: Ich bin erst bei der Hälfte, ich werde weiterlesen, wahrscheinlich sogar schneller als Nadj Abonji. So funktioniert es eben, das Geschäft mit dem Schrecken.
Zum Glück funktioniert Literatur nicht immer so – und damit wäre ich bei der Besprechung meiner derzeitigen Lektüren. Ich hatte mir nämlich letztes Jahr anhand des Feuilletons ein paar Wunschbücher zusammengesucht und mich dann zu Weihnachten beschenken lassen. Da ich derzeit nur abends im Bett ein paar Minuten zum Lesen komme, gehörten der Januar und der Februar vollständig Melinda Nadj Abonjis „Tauben fliegen auf“, dem autobiografisch gefärbten Roman über zwei ungarisch-stämmige Schwestern aus der jugoslawischen Vojvodina, die als Kinder mit ihren Eltern in die Schweiz auswandern, den Jugoslawien-Krieg nur noch von außen, als Entronnene, durch unsichere Nachrichten aus der verlorenen Heimat, mitbekommen. Da geriet ich am Ende tatsächlich wieder in die oben beschriebene Politik-Falle: Ich ließ mich zwar hinreißen vom ungelenk-schwungvollen Charme des balkanesischen Wortschwalls (der Titel „Tauben fliegen auf“ charakterisiert diesen deutlich), war gerührt von der eindringlichen Darstellung, wie es ist, in der Fremde zu leben (wo ja niemand, auch der nicht der coolste Wirtschaftsflüchtling, als der der Vater der Familie sich gern ausgibt, ganz freiwillig ist) ... Ich ließ mich rühren und blieb dennoch unzufrieden, weil man so rein gar nichts erfährt über die Vorgänge in Jugoslawien – und dann auch noch verspottet wird, weil man das wissen will: „und wahrscheinlich würde Herrn Tognoni, Herrn und Frau Berger und die Schärers das, was ich von meinem Land erzählen wollte, nicht interessieren, es wäre gut möglich, dass sie mich etwas verlegen und mitleidig anschauen würden: Fräulein, wir dachten da an etwas Anderes, wir wollten etwas über die Kultur, die Geschichte, die Sprache, die Probleme erfahren – und nicht über die Luft zwischen den majestätischen Pappeln und Akazien, die winzigen Blumen, die zwischen den Pflastersteinen wachsen, ...“ (S. 241). Dabei hätte die Geschichte durchaus Anlass gegeben, gesellschaftlich konkreter zu werden: Der Cousin der Ich-Erzählerin wird zum Kriegsdienst gezwungen und abgeführt - und verschwindet einfach aus der Geschichte. Das ist realistisch, aber lässt den Leser unbefriedigt. Es bleibt eine Leerstelle.
Vielleicht hängt es auch mit dieser Leerstelle zusammen, dass die Erzählerin sich später in einen offenbar traumatisierten Jungen aus Sarajewo verliebt. Aber auch der erzählt nichts. Verständlich, aber unbefriedigend. Was bleibt, ist das hilflose Mitgefühl der Erzählerin, z. B. gegenüber ihrem Vater: „einen Moment lang schaue ich meinem Vater in die schutzlosen Augen, und ich würde gern einen Trost finden, mein Herz würde ihn gern geben, diesen Trost, jetzt, da mein Vater ein hilfloses Kind ist, aber ich, ich bin auch ein hilfloses Kind, seines, wenigstens das würde ich ihm gern sagen, ich stehe auf, verschwinde rasch in Richtung Toilette.“ (S. 163).
Welche Größe in dieser Selbstbescheidung liegt, in diesem Verzicht, die Schrecklichkeiten alle zu benennen, das begriff ich erst, als ich zum nächsten Buch griff: Sofi Oksanen „Fegefeuer“, Thema: eine andere Menschheitskatastrophe am Rande des russischen Imperiums: Estland zwischen den dreißiger Jahren und heute. Hier wird alles deutlich ausgesprochen, überdeutlich sogar. Jedes Verbrechen, jede Gemeinheit. Selbst die Fliege, die auch das Cover des Buches ziert, fliegt in ausführlich beschriebener Scheußlichkeit durch die Küche der Protagonistin und legt ihre Eier in jedes erreichbare Stückchen Fleisch. Diese Erzähltechnik lässt den Leser in Schockstarre verfallen, gebannt das Geschehen verfolgen. Zumal immer irgendetwas passiert – Spannung garantiert. Aber ehrlich gesagt: Historisch Neues erfährt man trotz Überdeutlichkeit nicht – dass erst die Russen die Esten deportierten, dann die Deutschen die Juden, dass erst die Kommunisten die national gesinnten Esten, dann diese wiederum die Kommunisten verfolgten und dass heutzutage mafiöse Organisationen, die sich teilweise auch aus ehemaligen KGB-Leuten rekrutieren, den Menschenhandel von Russinnen zur Prostitution nach Deutschland organisieren, das ist eigentlich schon bekannt. Das Wie hätte mich interessiert. Aber Psychologie ist nicht die Sache der Autorin. Das ärgert mich. Und dennoch: Ich bin erst bei der Hälfte, ich werde weiterlesen, wahrscheinlich sogar schneller als Nadj Abonji. So funktioniert es eben, das Geschäft mit dem Schrecken.
... link (0 Kommentare) ... comment
Sonntag, 31. Oktober 2010
Der Kongo als Kriegsschauplatz – TV-Drama mit Jörg Schüttauf
damals, 20:26h
Neulich kam ein TV-Drama mit dem Titel „Kongo“. Es sollte um den Bundeswehreinsatz 2006 dort gehen, „TV Spielfilm“ war begeistert und irgendeinen Filmpreis gab es auch. Ich war neugierig (dass die Bundeswehr im Kongo war, hatte ich gar nicht mitgekriegt – 2006 hatte ich grad andere Probleme als regelmäßig die Nachrichten zu verfolgen). Ich nahm den Film auf und kam vor ein paar Tagen endlich dazu, ihn zu gucken.
Über den Kongo war aber leider nichts zu erfahren, was über das banalste Stammtischwissen hinausgeht. Natürlich hatte man irgendwo einen Kurzdialog über den kongolesischen Rohstoffreichtum im Dienste der 1. Welt in das Drehbuch montiert, ebenso wie ein paar Hinweise auf mystisches Denken bei den Eingeborenen, die wohl Lokalkolorit und Rückständigkeit andeuten sollten. Der Kommandeur der Truppe ließ auch einen vagen Halbsatz über den Grund für den Einsatz fallen. Relevanz für die Handlung hatte das alles nicht. Für die waren bloß die Kindersoldaten und Rebellen wichtig, da ja in einem TV-Drama immer irgendjemand den Part des Bösen übernehmen muss.
Überhaupt die Handlung: durchaus fesselnd, aber nach Schema F gestrickt – ein Selbstmord, dessen Hintergründe vertuscht werden, eine Ermittlerin als Heldin (jung, hübsch, Oberleutnant), ihre Gegenspieler zwei Machos, von denen der eine den guten und der andere den bösen Bullen darstellt, am Ende scheitert die Idealistin tragisch und der böse Bulle mindert seine Schuld, indem er mit männlich-entschiedenem Einsatz das Schlimmste verhindert. Afrika, sofern es außerhalb des Militärlagers existierte, bildete den passenden Hintergrund aus Naturschönheit und armen Opfern (teilweise bemitleidenswert, teilweise gefährlich verstrickt, in jedem Fall aber: fremd, nicht vertrauenswürdig).
Ich, der etwas über den Kongo und, was die Deutschen dort so getrieben haben, erfahren wollte, war enttäuscht: Das Ganze hätte genauso gut in Afghanistan oder sonstwo spielen können, der Schauplatz inklusive einheimischer Bevölkerung war völlig austauschbar. Wenn irgendetwas echt war an der Geschichte, dann die Nöte der Soldaten, die in eine fremde, feindliche Umgebung und in einen Konflikt, den sie nicht verstehen, geworfen werden. Und tatsächlich – als ich nachgoogelte, erfuhr ich, dass sich der Plot an Motiven „am Hindukusch“ passierter Vorfälle orientiert.
Aber auch, was den Kongo betrifft, wurde ich im Internet fündig. Schon die Erlebnisse von Frau damenwahl hatten in mir ja – wie bei Herrn Stubenzweig – die Frage ausgelöst, was da eigentlich los ist. Eine mir einleuchtende Darstellung der Situation fand ich hier, und die hat mich schwer beeindruckt: Ich erfuhr, dass die heutigen Konflikte nicht nur Nachwehen eines besonders schlimmen Kolonialzeit waren, auch nicht nur Folgen des Mordes am ersten Präsidenten des unabhängigen Kongo durch belgische Söldner oder der darauf folgenden Diktatur durch Mobutu (einer echten Pinochet-Saddam-Figur von US-Gnaden), sondern dass auch im Jahr 2000 wieder ein kongolesischer Präsident durch westliche Geheimnisdienste ermordet wurde. Und dass der besagte Bundeswehreinsatz dazu diente, die Wahl des aktuellen Frankreich-Lieblings abzusichern. Die Führung dieses Militäreinsatzes wollte halt Frankreich aus Prestige-Gründen nicht schon wieder übernehmen - und Deutschland war grade scharf darauf, seine Auslandstruppen international zu etablieren.
So betrachtet war die Entscheidung des Drehbuchautors, die Geschichte im Kongo anzusiedeln, gar nicht schlecht: Wenn er weg wollte von der politisch aufgeheizten Tagesdiskussion um Afghanistan, wenn es darum ging, das Publikum daran zu gewöhnen, dass deutsche Soldaten in x-beliebige Länder der 3. Welt geschickt werden, in Konflikte, von denen sie keine Ahnung haben und auch nicht haben sollen, dann waren die Schauplatzwahl Kongo und das Ausblenden jeglicher gesellschaftlicher Hintergründe sicher eine gute Wahl: einfach professionell. Es gibt nämlich einen Grad an Professionalität, der Volksverdummung gleichkommt.
Über den Kongo war aber leider nichts zu erfahren, was über das banalste Stammtischwissen hinausgeht. Natürlich hatte man irgendwo einen Kurzdialog über den kongolesischen Rohstoffreichtum im Dienste der 1. Welt in das Drehbuch montiert, ebenso wie ein paar Hinweise auf mystisches Denken bei den Eingeborenen, die wohl Lokalkolorit und Rückständigkeit andeuten sollten. Der Kommandeur der Truppe ließ auch einen vagen Halbsatz über den Grund für den Einsatz fallen. Relevanz für die Handlung hatte das alles nicht. Für die waren bloß die Kindersoldaten und Rebellen wichtig, da ja in einem TV-Drama immer irgendjemand den Part des Bösen übernehmen muss.
Überhaupt die Handlung: durchaus fesselnd, aber nach Schema F gestrickt – ein Selbstmord, dessen Hintergründe vertuscht werden, eine Ermittlerin als Heldin (jung, hübsch, Oberleutnant), ihre Gegenspieler zwei Machos, von denen der eine den guten und der andere den bösen Bullen darstellt, am Ende scheitert die Idealistin tragisch und der böse Bulle mindert seine Schuld, indem er mit männlich-entschiedenem Einsatz das Schlimmste verhindert. Afrika, sofern es außerhalb des Militärlagers existierte, bildete den passenden Hintergrund aus Naturschönheit und armen Opfern (teilweise bemitleidenswert, teilweise gefährlich verstrickt, in jedem Fall aber: fremd, nicht vertrauenswürdig).
Ich, der etwas über den Kongo und, was die Deutschen dort so getrieben haben, erfahren wollte, war enttäuscht: Das Ganze hätte genauso gut in Afghanistan oder sonstwo spielen können, der Schauplatz inklusive einheimischer Bevölkerung war völlig austauschbar. Wenn irgendetwas echt war an der Geschichte, dann die Nöte der Soldaten, die in eine fremde, feindliche Umgebung und in einen Konflikt, den sie nicht verstehen, geworfen werden. Und tatsächlich – als ich nachgoogelte, erfuhr ich, dass sich der Plot an Motiven „am Hindukusch“ passierter Vorfälle orientiert.
Aber auch, was den Kongo betrifft, wurde ich im Internet fündig. Schon die Erlebnisse von Frau damenwahl hatten in mir ja – wie bei Herrn Stubenzweig – die Frage ausgelöst, was da eigentlich los ist. Eine mir einleuchtende Darstellung der Situation fand ich hier, und die hat mich schwer beeindruckt: Ich erfuhr, dass die heutigen Konflikte nicht nur Nachwehen eines besonders schlimmen Kolonialzeit waren, auch nicht nur Folgen des Mordes am ersten Präsidenten des unabhängigen Kongo durch belgische Söldner oder der darauf folgenden Diktatur durch Mobutu (einer echten Pinochet-Saddam-Figur von US-Gnaden), sondern dass auch im Jahr 2000 wieder ein kongolesischer Präsident durch westliche Geheimnisdienste ermordet wurde. Und dass der besagte Bundeswehreinsatz dazu diente, die Wahl des aktuellen Frankreich-Lieblings abzusichern. Die Führung dieses Militäreinsatzes wollte halt Frankreich aus Prestige-Gründen nicht schon wieder übernehmen - und Deutschland war grade scharf darauf, seine Auslandstruppen international zu etablieren.
So betrachtet war die Entscheidung des Drehbuchautors, die Geschichte im Kongo anzusiedeln, gar nicht schlecht: Wenn er weg wollte von der politisch aufgeheizten Tagesdiskussion um Afghanistan, wenn es darum ging, das Publikum daran zu gewöhnen, dass deutsche Soldaten in x-beliebige Länder der 3. Welt geschickt werden, in Konflikte, von denen sie keine Ahnung haben und auch nicht haben sollen, dann waren die Schauplatzwahl Kongo und das Ausblenden jeglicher gesellschaftlicher Hintergründe sicher eine gute Wahl: einfach professionell. Es gibt nämlich einen Grad an Professionalität, der Volksverdummung gleichkommt.
... link (4 Kommentare) ... comment
Samstag, 26. Juni 2010
Vor 65 Jahren war der Krieg vorbei - kleine Gedenkrezension, Teil 2: Darf eine „Anonyma“ anonym bleiben und wer hindert sie eigentlich daran?
damals, 14:47h
Ich weiß, ich bin mal wieder zu spät: Der Gedenktag ist lang vorbei, meine erste Rezension zm Thema "Kriegsende" hab ich auch schon vor einem Monat geschrieben; ich referiere eine Debatte aus dem Jahr 2004 und auch die unvermeidliche Verfilmung der "Anonyma" ist schon nicht mehr ganz aktuell. Aber ich gehe davon, dass sich meine Leser (seid gegrüßt, Ihr 5 -6 Getreuen!) dennoch an meinem Text erfreuen. Er ist das Ergebnis der Tatsache, dass ich letzte Woche ein bisschen Zeit und Muße hatte, um mal dem Tipp von K.Modick nachzugehen, dass es mit der Authentizität des Textes nicht allzu weit her sei.
Das Internet ist ja herrlich, es gab mir prompt einige Auskünfte, und danach stellt sich die Sache so dar: Eine Journalistin erlebt das Kriegende in Berlin, und das war für eine junge Frau ein grausiges Erlebnis, wie wir heute wissen. Sie notiert die Geschehnisse in einem Tagebuch, also für sich. Das Tagebuch zur Veröffentlichung freizugeben, dazu überredet sie zehn Jahre später ein guter Freund. Dieser Freund, ebenfalls Journalist, hat sich in den Kriegsjahren als propagandistischer Kriegsberichterstatter hervorgetan, es gelang ihm aber, nach dem Krieg eine zweite Karriere als Autor und Rowohlt-Lektor aufzubauen. Der Freund übernimmt das Manuskript (und überarbeitet es?), zunächst für eine amerikanische Ausgabe. Offenbar hat er – wie schon in den vierziger Jahren – einen guten Riecher für erfolgversprechende Trends: In den USA der 50er Jahre lassen sich russische Vergewaltiger gut verkaufen. Das Buch wird ein Erfolg. Davon angespornt bereitet der Mann auch eine deutsche Ausgabe vor. Diese aber floppt: In Deutschland ist Schweigen über die Vergangenheit angesagt. Hier haben einige einiges zu vertuschen, und damit das nicht so auffällt, schweigt man überhaupt, über Täter ebenso wie über Opfer. Und über Frauen sowieso.
Das Blatt wendet sich ein paar Jahrzehnte später. Die Kriegsgeneration ist alt, Lebensrückschau, sentimentales Erinnern angesagt. Diesmal ist es H. M. Enzensberger, der den guten Riecher hat: Er veranstaltet in seiner „Anderen Bibliothek“ (im Eichborn-Verlag) eine Neuausgabe des Buches – ein Riesenerfolg. Ob und inwiefern der Text nachbearbeitet oder nicht ganz echt sein könnte, prüft er nicht, wozu auch. Dann erhebt sich aber doch Protest. Jens Bisky weist in der „Süddeutschen Zeitung“ auf die Nazivergangenheit des Herausgebers hin, Gustav Seibt schließt sich ihm an. Da auch sie nicht wissen, ob bzw. wie authentisch der Text ist, werden sie stark angegriffen. Endlich kommt ein Journalist der ZEIT auf die Idee, die Witwe und Nachlassverwalterin des Herausgebers zu kontaktieren. Zum vereinbarten Treffen mit ihr ist aber ein Mitarbeiter des Eichborn-Verlags anwesend, der den Einblick in das Originalmanuskript verhindert.
Klar, dass das der Verlag nicht auf sich sitzen lassen kann – er bestellt einen Gutachter: Walter Kempowski. Das ist eine gute Wahl, Kempowski hat in derselben Zeit wie die Anonyma ebenfalls genug Schlimmes durch die Russen erlebt, so dass man sich seines Antikommunismus sicher sein kann. Allerdings ist er nicht nur Antikommunist, sondern auch korrekt. So erledigt er erstmal seinen Auftrag und erklärt, dass alle Geschehnisse im Buch authentisch sind und auf den Originialaufzeichnungen basieren. (Daran hat allerdings auch nie jemand gezweifelt, wie J. Güntner in NZZ richtig anmerkt.) Der in knappem Stil gehaltene, teilweise unfertige Text des Tagebuchs wurde später lediglich etwas literarisiert. Auch das ist ja normal. Interessant wäre die Frage, wer hier überarbeitet hat. Kempowski sagt (auftragsgemäß), er hätte keinen Hinweis auf das Eingreifen des Herausgebers finden können. Er sagt aber auch, warum: Es gebe, so hat er erfahren, neben abgetipptem Originalmanuskript und Buchausgabe noch ein drittes Manuskript, über das sich alle Beteiligten ausschweigen.
Fazit: Zwei Frauen (eine Autorin, eine Nachlassverwalterin) und viele Männer, eine schlimmes Schicksal und viele, die damit rumgetrickst haben. Und sicher ist nur eins: Was derzeit über die Leinwände flimmert (und von Max Färberböck sicherlich akkurat in Szene gesetzt wurde), basiert auf einer Literarisierung im Geist der 50er (oder sogar der frühen 40er?) Jahre. Und passt damit hervorragend in unsere Zeit.
Das Internet ist ja herrlich, es gab mir prompt einige Auskünfte, und danach stellt sich die Sache so dar: Eine Journalistin erlebt das Kriegende in Berlin, und das war für eine junge Frau ein grausiges Erlebnis, wie wir heute wissen. Sie notiert die Geschehnisse in einem Tagebuch, also für sich. Das Tagebuch zur Veröffentlichung freizugeben, dazu überredet sie zehn Jahre später ein guter Freund. Dieser Freund, ebenfalls Journalist, hat sich in den Kriegsjahren als propagandistischer Kriegsberichterstatter hervorgetan, es gelang ihm aber, nach dem Krieg eine zweite Karriere als Autor und Rowohlt-Lektor aufzubauen. Der Freund übernimmt das Manuskript (und überarbeitet es?), zunächst für eine amerikanische Ausgabe. Offenbar hat er – wie schon in den vierziger Jahren – einen guten Riecher für erfolgversprechende Trends: In den USA der 50er Jahre lassen sich russische Vergewaltiger gut verkaufen. Das Buch wird ein Erfolg. Davon angespornt bereitet der Mann auch eine deutsche Ausgabe vor. Diese aber floppt: In Deutschland ist Schweigen über die Vergangenheit angesagt. Hier haben einige einiges zu vertuschen, und damit das nicht so auffällt, schweigt man überhaupt, über Täter ebenso wie über Opfer. Und über Frauen sowieso.
Das Blatt wendet sich ein paar Jahrzehnte später. Die Kriegsgeneration ist alt, Lebensrückschau, sentimentales Erinnern angesagt. Diesmal ist es H. M. Enzensberger, der den guten Riecher hat: Er veranstaltet in seiner „Anderen Bibliothek“ (im Eichborn-Verlag) eine Neuausgabe des Buches – ein Riesenerfolg. Ob und inwiefern der Text nachbearbeitet oder nicht ganz echt sein könnte, prüft er nicht, wozu auch. Dann erhebt sich aber doch Protest. Jens Bisky weist in der „Süddeutschen Zeitung“ auf die Nazivergangenheit des Herausgebers hin, Gustav Seibt schließt sich ihm an. Da auch sie nicht wissen, ob bzw. wie authentisch der Text ist, werden sie stark angegriffen. Endlich kommt ein Journalist der ZEIT auf die Idee, die Witwe und Nachlassverwalterin des Herausgebers zu kontaktieren. Zum vereinbarten Treffen mit ihr ist aber ein Mitarbeiter des Eichborn-Verlags anwesend, der den Einblick in das Originalmanuskript verhindert.
Klar, dass das der Verlag nicht auf sich sitzen lassen kann – er bestellt einen Gutachter: Walter Kempowski. Das ist eine gute Wahl, Kempowski hat in derselben Zeit wie die Anonyma ebenfalls genug Schlimmes durch die Russen erlebt, so dass man sich seines Antikommunismus sicher sein kann. Allerdings ist er nicht nur Antikommunist, sondern auch korrekt. So erledigt er erstmal seinen Auftrag und erklärt, dass alle Geschehnisse im Buch authentisch sind und auf den Originialaufzeichnungen basieren. (Daran hat allerdings auch nie jemand gezweifelt, wie J. Güntner in NZZ richtig anmerkt.) Der in knappem Stil gehaltene, teilweise unfertige Text des Tagebuchs wurde später lediglich etwas literarisiert. Auch das ist ja normal. Interessant wäre die Frage, wer hier überarbeitet hat. Kempowski sagt (auftragsgemäß), er hätte keinen Hinweis auf das Eingreifen des Herausgebers finden können. Er sagt aber auch, warum: Es gebe, so hat er erfahren, neben abgetipptem Originalmanuskript und Buchausgabe noch ein drittes Manuskript, über das sich alle Beteiligten ausschweigen.
Fazit: Zwei Frauen (eine Autorin, eine Nachlassverwalterin) und viele Männer, eine schlimmes Schicksal und viele, die damit rumgetrickst haben. Und sicher ist nur eins: Was derzeit über die Leinwände flimmert (und von Max Färberböck sicherlich akkurat in Szene gesetzt wurde), basiert auf einer Literarisierung im Geist der 50er (oder sogar der frühen 40er?) Jahre. Und passt damit hervorragend in unsere Zeit.
... link (0 Kommentare) ... comment
Dienstag, 11. Mai 2010
Vor 65 Jahren war der Krieg vorbei - kleine Gedenkrezension
damals, 02:44h
Sozusagen in Gedenken an das 65 Jahre zurückliegende Kriegsende rezensiere ich (in schwarz-weiß-malerischer Absicht) zwei Texte darüber. Heute geht es um die Erzählung „Ein Kriegsende“ von Siegried Lenz aus dem Jahr 1983., die eher zufällig auf meinen Nachttisch geriet und mich sofort in ihren Bann zog, wenn auch nicht unbedingt im positiven Sinne. In der Geschichte berichtet ein Ich-Erzähler, wie er das Kriegsende auf einem Minensuchboot erlebte. Die Mannschaft fuhr gerade über die Ostsee, um irgendwo im Ostpreußischen Verwundete aufzunehmen (Anfang 1945 ein halsbrecherischer Auftrag, wie man sich denken kann), als die Nachricht von der Kapitulation kommt. Es entspinnt sich eine Diskussion darüber, ob man die gefährliche Aktion abbrechen kann oder muss, um als Besiegter heimzukehren. Der Kapitän will weiterfahren, der Steuermann nicht und wird von einem auf das Boot strafversetzten Besatzungsmitglied zur Meuterei aufgestachelt. Man kehrt zurück, wird verhaftet, die beiden Aufrührer erschossen. Obwohl der Krieg eigentlich schon vorbei ist.
Das ist eine Geschichte, die ins Innerste militärischer Logik führt: Darf und muss man ab dem Zeitpunkt einer Kapitulation sofort jegliches militärische Handeln unterlassen? Wiegt die Rettung in Ostpreußen festsitzender Kameraden schwerer als das Leben der eigenen Mannschaft? Endlich: Darf die Entscheidung eines militärischen Vorgesetzten angezweifelt werden? Alles unschöne, hässliche, vielleicht notwendige Fragen. Aber es ist schon merkwürdig, wenn angesichts eines Kriegsendes immer noch Fragen des Krieges verhandelt werden und die Sehnsucht nach dem Ende, die Hoffnung, dass bald alles überstanden ist, erzählerisch eher die Rolle des Verführers spielt. Wenn der Strafversetzte vorsichtig negativ gezeichnet wird – im Gegensatz zu Steuermann und Kapitän, die uns als ehrliche Fischer vorgestellt werden, die eben, wenn es sein muss, ihren Dienst tun. Und besonders merkwürdig finde ich diesen Ich-Erzähler, der die Geschehnisse atmosphärisch sensibel beschreibt, in einer ganz unmilitärischen Sprache („Unser Minensucher glitt mit kleiner Fahrt durch den Sund ...“), und sich doch widerstandslos dem Sog dieser militärischen Logik hingibt. Er sieht alles, sagt nichts und hat immer Kopfschmerzen. Das einzige Mal, dass er als Figur in Erscheinung tritt, ist die Stelle, wie er vor dem Militärgericht den verehrten Steuermann zu retten versucht, indem er den ohnehin verlorenen Strafversetzten anschwärzt.
Und das Ganze dann 1983 geschrieben! Über dreißig Jahre nach „Die Mörder sind unter uns“, sogar noch nach der Filbinger-Entlarvung. Da kann doch eine Erzählung nicht mehr so enden: mit dem naiven Entsetzen darüber, dass uns unsere Vorgesetzten so enttäuschen und einfach zwei unserer Kameraden erschießen, obwohl ihre juristische Berechtigung dazu sehr in Frage steht. Das schmeckt mir sehr nach Untertanengeist (à la „ich bin ja ein Schöngeist, aber wenn nun mal Krieg ist ...“). Vielleicht wär ich auch nicht besser, ich erinner mich gut, wie stolz ich auf die Beherrschung der bescheuerten Kanone war, an die man mich mit 18 zwang. Aber schön ist das trotzdem nicht.
Das ist eine Geschichte, die ins Innerste militärischer Logik führt: Darf und muss man ab dem Zeitpunkt einer Kapitulation sofort jegliches militärische Handeln unterlassen? Wiegt die Rettung in Ostpreußen festsitzender Kameraden schwerer als das Leben der eigenen Mannschaft? Endlich: Darf die Entscheidung eines militärischen Vorgesetzten angezweifelt werden? Alles unschöne, hässliche, vielleicht notwendige Fragen. Aber es ist schon merkwürdig, wenn angesichts eines Kriegsendes immer noch Fragen des Krieges verhandelt werden und die Sehnsucht nach dem Ende, die Hoffnung, dass bald alles überstanden ist, erzählerisch eher die Rolle des Verführers spielt. Wenn der Strafversetzte vorsichtig negativ gezeichnet wird – im Gegensatz zu Steuermann und Kapitän, die uns als ehrliche Fischer vorgestellt werden, die eben, wenn es sein muss, ihren Dienst tun. Und besonders merkwürdig finde ich diesen Ich-Erzähler, der die Geschehnisse atmosphärisch sensibel beschreibt, in einer ganz unmilitärischen Sprache („Unser Minensucher glitt mit kleiner Fahrt durch den Sund ...“), und sich doch widerstandslos dem Sog dieser militärischen Logik hingibt. Er sieht alles, sagt nichts und hat immer Kopfschmerzen. Das einzige Mal, dass er als Figur in Erscheinung tritt, ist die Stelle, wie er vor dem Militärgericht den verehrten Steuermann zu retten versucht, indem er den ohnehin verlorenen Strafversetzten anschwärzt.
Und das Ganze dann 1983 geschrieben! Über dreißig Jahre nach „Die Mörder sind unter uns“, sogar noch nach der Filbinger-Entlarvung. Da kann doch eine Erzählung nicht mehr so enden: mit dem naiven Entsetzen darüber, dass uns unsere Vorgesetzten so enttäuschen und einfach zwei unserer Kameraden erschießen, obwohl ihre juristische Berechtigung dazu sehr in Frage steht. Das schmeckt mir sehr nach Untertanengeist (à la „ich bin ja ein Schöngeist, aber wenn nun mal Krieg ist ...“). Vielleicht wär ich auch nicht besser, ich erinner mich gut, wie stolz ich auf die Beherrschung der bescheuerten Kanone war, an die man mich mit 18 zwang. Aber schön ist das trotzdem nicht.
... link (0 Kommentare) ... comment
Dienstag, 6. April 2010
Die untote Ossi (Filmkritik zu "Yella")
damals, 21:40h
Es gibt ein schönes Denkmal für den deutschen Autorenfilmer, und zwar ist das die Figur, die Florian Lukas in „Good bye, Lenin“ verkörpert: ein eigenbrötlerischer Bastler und Spinner, der amerikanische Filme liebt und zu Hause originelle und abstruse Filmideen verwirklicht.
Ein solcher Film ist mir mal wieder begegnet: kein großes Kino, dazu sind die Bilder zu simpel, mitunter bringen linke Ideologismen den Dialog zum Holpern und die symbolisch eingesetzten Soundeffekte wirken auch manchmal ein bisschen künstlich. Man spürt dem Film das Selbstgebastelte an. Dafür hat er aber auch alle Vorteile des Selbstgebastelten: Er ist originell, klug, teilweise richtig raffiniert. Nirgends mainstream, keine Minute langweilig (und außerdem sind die Schauspieler wirlich professionell).
Ich spreche von „Yella“, einem Film von Christian Petzold aus dem Jahr 2007. Ich sehne mich schon lang nach dem Film. Immerhin ist er vom Regisseur von „Innere Sicherheit“ und er spielt teilweise in Wittenberge, in der ostdeutschen Provinz – zwei Gründe, die reflexartig Sehnsucht in mir auslösen.
Yella (was für ein exotischer Name in so einer banalen Gegend) lebt in Wittenberge. Es ist Frühling, man sieht leere Straßen, leere Häuser, frisches Grün und kann Yella nur zu gut verstehen, die die gescheiterte Firmengründung und den von Wessis übertölpelten Ex-Freund zurücklassen will, um im sprichwörtlich hässlichen Hannover ein neues Leben zu beginnen. Aber ebendieser Exfreund stürzt sich und sie mit dem Auto von einer Brücke in die Elbe und fortan stolpert sie (nach dem Vorbild des herrlichen amerikanischen B-Movies „Karneval der Seelen“) als Untote durch Westdeutschland, betrügt als Assistentin eines Finanzgauners so geistesabwesend wie cool irgendwelche Investoren und wird verfolgt vom Geist ihres Exfreunds. Und natürlich muss sie ihm endlich ins Totenreich folgen.
Aber anders als die Hauptfigur aus „Karneval der Seelen“, die einfach leben will und sich deshalb dem Tod verweigert, versteht man bei Yella nicht so recht, was sie in der Welt der Lebenden eigentlich noch sucht. Lebendigkeit jedenfalls kann es nicht sein, wie magisch ist sie angezogen vom Finanzmilieu, in dem emotionslos und mit falschen Gesten um Werte gepokert wird, die es gar nicht gibt. Super erkannt vom Regisseur: Es ist ein Milieu der Untoten. Toter als diese Geschäftsverhandlungen ist eigentlich nur noch eins: der Schemen des Exfreunds Ben, wenn er schattenhaft in ihrem Hotelzimmer erscheint und von einer Normalo-Ehe fabuliert: „Ich werde wieder arbeiten gehen, als Installateur. Wir nehmen uns eine Wohnung. Du kannst doch so hübsch einrichten.“
Was will Yella in dieser Zombie-Welt, in der sie sich wahrhaft traumwandlerisch behauptet? Man wird den Verdacht nicht los, dass es um Rache geht, ein eher todessüchtiger als lebensbejahender Grund. Darauf deutet hin, dass ihr die Erkenntnisse aus dem Wittenberger Konkurs-Erlebnis die Idee zu ihrem ersten Trick auf dem West-Parkett verhelfen. Ein zweiter Hinweis: Ihr letzter Geschäftsgegner hat eine Ehefrau und ein Zuhause, die dem von Yellas erstem Hannoveraner Chef zum Verwechseln ähneln. Der Hannoveraner hatte Yella persönlich aufs Gemeinste entwürdigt. Sein Dessauer Nachahmer oder Wiedergänger, obwohl persönlich eher sympathisch, wird von ihr stellvertretend in den Tod getrieben (herrlich: Burkhard Klausner als Wasserleiche). Erst damit scheint ihr Auftrag erfüllt und sie kann von Ben nach Wittenberge und in den Tod heimgeholt werden.
Das leuchtet ein, erzähllogisch wie auch politisch: Nicht Helmut Kohl, sondern Günter Krause, nicht Wolfgang Schäuble, sondern Lothar de Maizière trafen der Hass und die Verachtung der Ostdeutschen. „Yella“ analysiert eindringlich, wie diese ostdeutschen Untoten entstanden sind - egal ob sie nun zur depressiven Untergruppe gehören wie ich (phlegmatisch und jammerfreudig) oder zur umtriebig aktiven wie Kai Pflaume oder Angela Merkel (handwerklich perfekt, aber affekt- und seelenlos).
Unbeantwortet bleibt aber die Frage, warum eigentlich der westdeutsche Kapitalismus so zombiehaft agiert. Es gibt eine Szene, da entführt Yella ihren Chef und Räuberhauptmann an den Ort ihres Todes, die Wittenberger Elbbrücke. Der Zuschauer erzittert, und tatsächlich öffnet der Wessi hier endlich seine Seele. Und es zeigt sich – eine Geschäftsidee.
Diese schreckliche Leere war der schlimmste Moment in dem Film. Und ehrlich gesagt: Ich glaube ihn nicht. Sollte der westdeutsche Geschäftsmann wirklich so hohl und seelenlos sein, wie das linkes Feindbild und neoliberales Selbstverständins einträchtig behaupten?! Dann wäre er ja auch ein Untoter und es müsste eine Elbbrücke geben, von der er einst gestürzt ist. Hm. Die Seele der westdeutschen Nachkriegselite ist offenbar noch nicht enträtselt.
Ein solcher Film ist mir mal wieder begegnet: kein großes Kino, dazu sind die Bilder zu simpel, mitunter bringen linke Ideologismen den Dialog zum Holpern und die symbolisch eingesetzten Soundeffekte wirken auch manchmal ein bisschen künstlich. Man spürt dem Film das Selbstgebastelte an. Dafür hat er aber auch alle Vorteile des Selbstgebastelten: Er ist originell, klug, teilweise richtig raffiniert. Nirgends mainstream, keine Minute langweilig (und außerdem sind die Schauspieler wirlich professionell).
Ich spreche von „Yella“, einem Film von Christian Petzold aus dem Jahr 2007. Ich sehne mich schon lang nach dem Film. Immerhin ist er vom Regisseur von „Innere Sicherheit“ und er spielt teilweise in Wittenberge, in der ostdeutschen Provinz – zwei Gründe, die reflexartig Sehnsucht in mir auslösen.
Yella (was für ein exotischer Name in so einer banalen Gegend) lebt in Wittenberge. Es ist Frühling, man sieht leere Straßen, leere Häuser, frisches Grün und kann Yella nur zu gut verstehen, die die gescheiterte Firmengründung und den von Wessis übertölpelten Ex-Freund zurücklassen will, um im sprichwörtlich hässlichen Hannover ein neues Leben zu beginnen. Aber ebendieser Exfreund stürzt sich und sie mit dem Auto von einer Brücke in die Elbe und fortan stolpert sie (nach dem Vorbild des herrlichen amerikanischen B-Movies „Karneval der Seelen“) als Untote durch Westdeutschland, betrügt als Assistentin eines Finanzgauners so geistesabwesend wie cool irgendwelche Investoren und wird verfolgt vom Geist ihres Exfreunds. Und natürlich muss sie ihm endlich ins Totenreich folgen.
Aber anders als die Hauptfigur aus „Karneval der Seelen“, die einfach leben will und sich deshalb dem Tod verweigert, versteht man bei Yella nicht so recht, was sie in der Welt der Lebenden eigentlich noch sucht. Lebendigkeit jedenfalls kann es nicht sein, wie magisch ist sie angezogen vom Finanzmilieu, in dem emotionslos und mit falschen Gesten um Werte gepokert wird, die es gar nicht gibt. Super erkannt vom Regisseur: Es ist ein Milieu der Untoten. Toter als diese Geschäftsverhandlungen ist eigentlich nur noch eins: der Schemen des Exfreunds Ben, wenn er schattenhaft in ihrem Hotelzimmer erscheint und von einer Normalo-Ehe fabuliert: „Ich werde wieder arbeiten gehen, als Installateur. Wir nehmen uns eine Wohnung. Du kannst doch so hübsch einrichten.“
Was will Yella in dieser Zombie-Welt, in der sie sich wahrhaft traumwandlerisch behauptet? Man wird den Verdacht nicht los, dass es um Rache geht, ein eher todessüchtiger als lebensbejahender Grund. Darauf deutet hin, dass ihr die Erkenntnisse aus dem Wittenberger Konkurs-Erlebnis die Idee zu ihrem ersten Trick auf dem West-Parkett verhelfen. Ein zweiter Hinweis: Ihr letzter Geschäftsgegner hat eine Ehefrau und ein Zuhause, die dem von Yellas erstem Hannoveraner Chef zum Verwechseln ähneln. Der Hannoveraner hatte Yella persönlich aufs Gemeinste entwürdigt. Sein Dessauer Nachahmer oder Wiedergänger, obwohl persönlich eher sympathisch, wird von ihr stellvertretend in den Tod getrieben (herrlich: Burkhard Klausner als Wasserleiche). Erst damit scheint ihr Auftrag erfüllt und sie kann von Ben nach Wittenberge und in den Tod heimgeholt werden.
Das leuchtet ein, erzähllogisch wie auch politisch: Nicht Helmut Kohl, sondern Günter Krause, nicht Wolfgang Schäuble, sondern Lothar de Maizière trafen der Hass und die Verachtung der Ostdeutschen. „Yella“ analysiert eindringlich, wie diese ostdeutschen Untoten entstanden sind - egal ob sie nun zur depressiven Untergruppe gehören wie ich (phlegmatisch und jammerfreudig) oder zur umtriebig aktiven wie Kai Pflaume oder Angela Merkel (handwerklich perfekt, aber affekt- und seelenlos).
Unbeantwortet bleibt aber die Frage, warum eigentlich der westdeutsche Kapitalismus so zombiehaft agiert. Es gibt eine Szene, da entführt Yella ihren Chef und Räuberhauptmann an den Ort ihres Todes, die Wittenberger Elbbrücke. Der Zuschauer erzittert, und tatsächlich öffnet der Wessi hier endlich seine Seele. Und es zeigt sich – eine Geschäftsidee.
Diese schreckliche Leere war der schlimmste Moment in dem Film. Und ehrlich gesagt: Ich glaube ihn nicht. Sollte der westdeutsche Geschäftsmann wirklich so hohl und seelenlos sein, wie das linkes Feindbild und neoliberales Selbstverständins einträchtig behaupten?! Dann wäre er ja auch ein Untoter und es müsste eine Elbbrücke geben, von der er einst gestürzt ist. Hm. Die Seele der westdeutschen Nachkriegselite ist offenbar noch nicht enträtselt.
... link (6 Kommentare) ... comment
Sonntag, 28. Februar 2010
Meine Lieblingsliste ...
damals, 17:46h
...umfasst (wenn ich nichts vergessen habe) 45 Titel, fast ausschließlich Belletristik, ich habe auch ein paar Sachbuchtitel reingeschmuggelt. Es sind fast alles längere oder kürzere Einzeltexte, im Ausnahmefall habe ich auch mal einen ganzen Erzählband genannt. Dramatik dagegen fehlt, denn das interessiert mich weniger. Schade ist das nur wegen Schiller, Horvath und Büchner – und wegen der „Trilogie des Wiedersehens“ von Botho Strauß. Und Lyrik habe ich ganz rausgelassen – ich verrate hier nur, dass meine Lieblingsgedichte Nr. 1 -3 von Hofmannsthal sind, ansonsten liebe ich (wie vermutlich jeder vernünftige Mensch) die Gedichte von Morgenstern und Ringelnatz – und von den Ausländern Alexander Blok und Emily Dickinson.
Auch meine Belletristik-Liste ist deutschlastig. Voilà !
1. Manfred Bieler, Maria Morzeck oder Das Kaninchen bin ich
2. Georg Büchner, Der hessische Landbote
3. Lewis Carrol, Alice im Wunderland
4. Stig Dagermann, Deutscher Herbst `46
5. Fjodor Dostojewski, Weiße Nächte
6. Hans Fallada, Geschichten aus der Murkelei
7. Hans Fallada, Lüttenweihnachten
8. Anne Frank, Tagebuch
9. Johann Wolfgang Goethe, Die Leiden des jungen Werthers
10. Maxim Gorki, Konowalow
11. Sebastian Haffner, Geschichte eines Deutschen
12. Christoph Hein, Der fremde Freund („Drachenblut“)
13. Christoph Hein, Der Tangospieler
14. Judith Hermann, Sonja
15. Judith Hermann, Zuhälter
16. Hermann Hesse, Unterm Rad
17. Wolfgang Hilbig, „Ich“
18. E.T.A. Hoffmann, Der goldene Topf
19. E.T.A. Hoffmann, Nussknacker und Mausekönig
20. Hugo von Hofmannsthal, Ein Brief
21. Hugo von Hofmannsthal, Reitergeschichte
22. Ödön von Horvath, Sportmärchen und kleine Prosa
23. Jens Peter Jacobsen, Niels Lyhne
24. Imre Kertész, Roman eines Schicksallosen
25. Eduard von Keyserling, Schwüle Tage
26. Thomas Mann, Buddenbrooks
27. Thomas Mann, Tonio Kröger
28. Gustav Meyrink, Des deutschen Spießers Wunderhorn
29. Hans Erich Nossack, Der Untergang
30. Orhan Pamuk, Istanbul
31. Orhan Pamuk, Schnee
32. Ulrich Plenzdorf, Die neuen Leiden des jungen W.
33. Ulrich Plenzdorf, kein runter kein fern
34. Wilhelm Raabe, Die Akten des Vogelsangs
35. Wilhelm Raabe, Hastenbeck
36. Wilhelm Raabe, Stopfkuchen
37. Erich Maria Remarque, Im Westen nichts Neues
38. Philip Roth, Der menschliche Makel
39. Arthur Schnitzler, Fräulein Else
40. Wassili Schukschin, Kalina Krasnaja
41. Frank Schulz, Morbus fonticuli oder Die Sehnsucht des Laien
42. Anna Seghers, Das siebte Kreuz
43. Anna Seghers, Transit
44. Botho Strauß, Wohnen Dämmern Lügen
45. Jens Wonneberger, Gegenüber brennt noch Licht
Auch meine Belletristik-Liste ist deutschlastig. Voilà !
1. Manfred Bieler, Maria Morzeck oder Das Kaninchen bin ich
2. Georg Büchner, Der hessische Landbote
3. Lewis Carrol, Alice im Wunderland
4. Stig Dagermann, Deutscher Herbst `46
5. Fjodor Dostojewski, Weiße Nächte
6. Hans Fallada, Geschichten aus der Murkelei
7. Hans Fallada, Lüttenweihnachten
8. Anne Frank, Tagebuch
9. Johann Wolfgang Goethe, Die Leiden des jungen Werthers
10. Maxim Gorki, Konowalow
11. Sebastian Haffner, Geschichte eines Deutschen
12. Christoph Hein, Der fremde Freund („Drachenblut“)
13. Christoph Hein, Der Tangospieler
14. Judith Hermann, Sonja
15. Judith Hermann, Zuhälter
16. Hermann Hesse, Unterm Rad
17. Wolfgang Hilbig, „Ich“
18. E.T.A. Hoffmann, Der goldene Topf
19. E.T.A. Hoffmann, Nussknacker und Mausekönig
20. Hugo von Hofmannsthal, Ein Brief
21. Hugo von Hofmannsthal, Reitergeschichte
22. Ödön von Horvath, Sportmärchen und kleine Prosa
23. Jens Peter Jacobsen, Niels Lyhne
24. Imre Kertész, Roman eines Schicksallosen
25. Eduard von Keyserling, Schwüle Tage
26. Thomas Mann, Buddenbrooks
27. Thomas Mann, Tonio Kröger
28. Gustav Meyrink, Des deutschen Spießers Wunderhorn
29. Hans Erich Nossack, Der Untergang
30. Orhan Pamuk, Istanbul
31. Orhan Pamuk, Schnee
32. Ulrich Plenzdorf, Die neuen Leiden des jungen W.
33. Ulrich Plenzdorf, kein runter kein fern
34. Wilhelm Raabe, Die Akten des Vogelsangs
35. Wilhelm Raabe, Hastenbeck
36. Wilhelm Raabe, Stopfkuchen
37. Erich Maria Remarque, Im Westen nichts Neues
38. Philip Roth, Der menschliche Makel
39. Arthur Schnitzler, Fräulein Else
40. Wassili Schukschin, Kalina Krasnaja
41. Frank Schulz, Morbus fonticuli oder Die Sehnsucht des Laien
42. Anna Seghers, Das siebte Kreuz
43. Anna Seghers, Transit
44. Botho Strauß, Wohnen Dämmern Lügen
45. Jens Wonneberger, Gegenüber brennt noch Licht
... link (8 Kommentare) ... comment
In Bloggersdorf kursiert eine Literaturliste ...
damals, 15:54h
... mit hundert bedeutsamen Buchtiteln. Ich habe schon bei einigen mit Interesse gelesen, was sie so gelesen haben - und wie es ihnen gefiel. Hier nun meine Version (alle Bücher, die ich mehr als angelesen habe - fett):
1. Der Herr der Ringe, JRR Tolkien
2. Die Bibel (teilweise, wird eher wie ein Lexikon benutzt)
3. Die Säulen der Erde, Ken Follett
4. Das Parfum, Patrick Süskind (banal)
5. Der kleine Prinz, Antoine de Saint-Exupéry (zu oft gelesen, kanns nicht mehr hören)
6. Buddenbrooks, Thomas Mann (herrlich: bürgerlich-konservativer Biedersinn und die geistreiche Eleganz und Dekadenz der Jahrhundertwende in einem Buch kombiniert – fast die Quadratur des Kreises)
7. Der Medicus, Noah Gordon
8. Der Alchimist, Paulo Coelho
9. Harry Potter und der Stein der Weisen, JK Rowling
10. Die Päpstin, Donna W. Cross
11. Tintenherz, Cornelia Funke (nett: macht Spaß zu lesen, prägt sich aber nicht ein)
12. Feuer und Stein, Diana Gabaldon
13. Das Geisterhaus, Isabel Allende
14. Der Vorleser, Bernhard Schlink (klug konstruiertes und stilistisch schlechtes Diskutierbuch – ideale Schullektüre, im schlechtesten Sinne deutsch)
15. Faust. Der Tragödie erster Teil, Johann Wolfgang von Goethe (super. Aber nicht mein Stil)
16. Der Schatten des Windes, Carlos Ruiz Zafón (hab ich nach 20 Seiten weggelegt, roch verdächtig nach süffig-banaler Schmökerliteratur)
17. Stolz und Vorurteil, Jane Austen
18. Der Name der Rose, Umberto Eco
19. Illuminati, Dan Brown
20. Effi Briest, Theodor Fontane (fand ich sterbenslangweilig, als ichs in der Schule lesen musste, würde mir heute vermutlich besser oder sogar gut gefallen)
21. Harry Potter und der Orden des Phönix, JK Rowling
22. Der Zauberberg, Thomas Mann (hab ich mit 22 begeistert gelesen, würde ich heute vermutlich spießig finden)
23. Vom Winde verweht, Margaret Mitchell
24. Siddharta, Hermann Hesse
25. Die Entdeckung des Himmels, Harry Mulisch (ich kenne nur den Film, der ist nicht schlecht)
26. Die unendliche Geschichte, Michael Ende
27. Das verborgene Wort, Ulla Hahn (hab ich auch nach zwanzig Seiten wegeglegt, ihre Gedichte mag ich auch nicht)
28. Die Asche meiner Mutter, Frank McCourt
29. Narziss und Goldmund, Hermann Hesse
30. Die Nebel von Avalon, Marion Zimmer Bradley
31. Deutschstunde, Siegfried Lenz (enttäuschend: betulich, tendenziell die Nazizeit verharmlosend)
32. Die Glut, Sándor Márai (hab "Die Gräfin von Parma" von ihm gelesen: mit großem Genuss weggeschmökert und sofort vergessen)
33. Homo faber, Max Frisch (hab ich gehasst – wie den ganzen Max Frisch)
34. Die Entdeckung der Langsamkeit, Sten Nadolny
35. Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins, Milan Kundera (ein gut geschriebenes, kluges und wichtiges Buch, zumindest für Ostblockgeborene – wenn auch in der Haltung machohaft und unsympathisch)
36. Hundert Jahre Einsamkeit, Gabriel Garcia Márquez
37. Owen Meany, John Irving
38. Sofies Welt, Jostein Gaarder (ganz doof)
39. Per Anhalter durch die Galaxis, Douglas Adams
40. Die Wand, Marlen Haushofer (ging so)
41. Gottes Werk und Teufels Beitrag, John Irving
42. Die Liebe in den Zeiten der Cholera, Gabriel Garcia Márquez
43. Der Stechlin, Theodor Fontane
44. Der Steppenwolf, Hermann Hesse (schönes Buch, wohl eins der besseren von Hesse)
45. Wer die Nachtigall stört, Harper Lee
46. Joseph und seine Brüder, Thomas Mann
47. Der Laden, Erwin Strittmatter
48. Die Blechtrommel, Günter Grass (genial und widerlich gleichzeitig)
49. Im Westen nichts Neues, Erich Maria Remarque (einfach super)
50. Der Schwarm, Frank Schätzing
51. Wie ein einziger Tag, Nicholas Sparks
52. Harry Potter und der Gefangene von Askaban, JK Rowling
53. Momo, Michael Ende
54. Jahrestage, Uwe Johnson
55. Traumfänger, Marlo Morgan
56. Der Fänger im Roggen, Jerome David Salinger
57. Sakrileg, Dan Brown
58. Krabat, Otfried Preußler
59. Pippi Langstrumpf, Astrid Lindgren
60. Wüstenblume, Waris Dirie
61. Geh, wohin dein Herz dich trägt, Susanna Tamaro
62. Hannas Töchter, Marianne Fredriksson
63. Mittsommermord, Henning Mankell
64. Die Rückkehr des Tanzlehrers, Henning Mankell
65. Das Hotel New Hampshire, John Irving
66. Krieg und Frieden, Leo N. Tolstoi
67. Das Glasperlenspiel, Hermann Hesse (bin irgendwann nach der Hälfte drin stecken geblieben – gute Grundidee, irgendwie zu abgehoben – und wesentlich zu lang)
68. Die Muschelsucher, Rosamunde Pilcher
69. Harry Potter und der Feuerkelch, JK Rowling
70. Tagebuch, Anne Frank (bewegend – aber weniger der Politik wegen, sondern wegen der authentisch geschilderten Pubertätsnöte, sie war der einzige Mensch, der mich verstand, als ich 14 war)
71. Salz auf unserer Haut, Benoite Groult
72. Jauche und Levkojen , Christine Brückner
73. Die Korrekturen, Jonathan Franzen (solide erzählter intellektueller Mainstream, mochte ich überhaupt nicht, hat mich teilweise regelrecht aggressiv gemacht)
74. Die weiße Massai, Corinne Hofmann
75. Was ich liebte, Siri Hustvedt
76. Die dreizehn Leben des Käpt’n Blaubär, Walter Moers
77. Das Lächeln der Fortuna, Rebecca Gablé
78. Monsieur Ibrahim und die Blumen des Koran, Eric-Emmanuel Schmitt
79. Winnetou, Karl May
80. Désirée, Annemarie Selinko
81. Nirgendwo in Afrika, Stefanie Zweig
82. Garp und wie er die Welt sah, John Irving (nach zwanzig Seiten weggelegt, konnte ich nichts mit anfangen)
83. Die Sturmhöhe, Emily Brontë
84. P.S. Ich liebe Dich, Cecilia Ahern
85. 1984, George Orwell (auch ein wichtiges, sehr aufrichtiges Buch – aber viel, viel zu politisch, ich hab irgendwann in der zweiten Hälfte aufgegeben)
86. Mondscheintarif, Ildiko von Kürthy
87. Paula, Isabel Allende
88. Solange du da bist, Marc Levy
89. Es muss nicht immer Kaviar sein, Johanns Mario Simmel
90. Veronika beschließt zu sterben, Paulo Coelho
91. Der Chronist der Winde, Henning Mankell
92. Der Meister und Margarita, Michail Bulgakow (hab ich früher über alles geliebt, als ich neulich nochmal reinlas, war es mir sehr fremd)
93. Schachnovelle, Stefan Zweig (rasant, elegant, banal – wer war das gleich, der Zweig als „Literaturfabrikant“ bezeichnete?)
94. Tadellöser & Wolff, Walter Kempowski
95. Anna Karenina, Leo N. Tolstoi
96. Schuld und Sühne, Fjodor Dostojewski
97. Der Graf von Monte Christo, Alexandre Dumas
98. Der Puppenspieler, Tanja Kinkel
99. Jane Eyre, Charlotte Brontë
100. Rote Sonne, schwarzes Land, Barbara Wood
Mein eigene Lieblingsliste folgt demnächst.
1. Der Herr der Ringe, JRR Tolkien
2. Die Bibel (teilweise, wird eher wie ein Lexikon benutzt)
3. Die Säulen der Erde, Ken Follett
4. Das Parfum, Patrick Süskind (banal)
5. Der kleine Prinz, Antoine de Saint-Exupéry (zu oft gelesen, kanns nicht mehr hören)
6. Buddenbrooks, Thomas Mann (herrlich: bürgerlich-konservativer Biedersinn und die geistreiche Eleganz und Dekadenz der Jahrhundertwende in einem Buch kombiniert – fast die Quadratur des Kreises)
7. Der Medicus, Noah Gordon
8. Der Alchimist, Paulo Coelho
9. Harry Potter und der Stein der Weisen, JK Rowling
10. Die Päpstin, Donna W. Cross
11. Tintenherz, Cornelia Funke (nett: macht Spaß zu lesen, prägt sich aber nicht ein)
12. Feuer und Stein, Diana Gabaldon
13. Das Geisterhaus, Isabel Allende
14. Der Vorleser, Bernhard Schlink (klug konstruiertes und stilistisch schlechtes Diskutierbuch – ideale Schullektüre, im schlechtesten Sinne deutsch)
15. Faust. Der Tragödie erster Teil, Johann Wolfgang von Goethe (super. Aber nicht mein Stil)
16. Der Schatten des Windes, Carlos Ruiz Zafón (hab ich nach 20 Seiten weggelegt, roch verdächtig nach süffig-banaler Schmökerliteratur)
17. Stolz und Vorurteil, Jane Austen
18. Der Name der Rose, Umberto Eco
19. Illuminati, Dan Brown
20. Effi Briest, Theodor Fontane (fand ich sterbenslangweilig, als ichs in der Schule lesen musste, würde mir heute vermutlich besser oder sogar gut gefallen)
21. Harry Potter und der Orden des Phönix, JK Rowling
22. Der Zauberberg, Thomas Mann (hab ich mit 22 begeistert gelesen, würde ich heute vermutlich spießig finden)
23. Vom Winde verweht, Margaret Mitchell
24. Siddharta, Hermann Hesse
25. Die Entdeckung des Himmels, Harry Mulisch (ich kenne nur den Film, der ist nicht schlecht)
26. Die unendliche Geschichte, Michael Ende
27. Das verborgene Wort, Ulla Hahn (hab ich auch nach zwanzig Seiten wegeglegt, ihre Gedichte mag ich auch nicht)
28. Die Asche meiner Mutter, Frank McCourt
29. Narziss und Goldmund, Hermann Hesse
30. Die Nebel von Avalon, Marion Zimmer Bradley
31. Deutschstunde, Siegfried Lenz (enttäuschend: betulich, tendenziell die Nazizeit verharmlosend)
32. Die Glut, Sándor Márai (hab "Die Gräfin von Parma" von ihm gelesen: mit großem Genuss weggeschmökert und sofort vergessen)
33. Homo faber, Max Frisch (hab ich gehasst – wie den ganzen Max Frisch)
34. Die Entdeckung der Langsamkeit, Sten Nadolny
35. Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins, Milan Kundera (ein gut geschriebenes, kluges und wichtiges Buch, zumindest für Ostblockgeborene – wenn auch in der Haltung machohaft und unsympathisch)
36. Hundert Jahre Einsamkeit, Gabriel Garcia Márquez
37. Owen Meany, John Irving
38. Sofies Welt, Jostein Gaarder (ganz doof)
39. Per Anhalter durch die Galaxis, Douglas Adams
40. Die Wand, Marlen Haushofer (ging so)
41. Gottes Werk und Teufels Beitrag, John Irving
42. Die Liebe in den Zeiten der Cholera, Gabriel Garcia Márquez
43. Der Stechlin, Theodor Fontane
44. Der Steppenwolf, Hermann Hesse (schönes Buch, wohl eins der besseren von Hesse)
45. Wer die Nachtigall stört, Harper Lee
46. Joseph und seine Brüder, Thomas Mann
47. Der Laden, Erwin Strittmatter
48. Die Blechtrommel, Günter Grass (genial und widerlich gleichzeitig)
49. Im Westen nichts Neues, Erich Maria Remarque (einfach super)
50. Der Schwarm, Frank Schätzing
51. Wie ein einziger Tag, Nicholas Sparks
52. Harry Potter und der Gefangene von Askaban, JK Rowling
53. Momo, Michael Ende
54. Jahrestage, Uwe Johnson
55. Traumfänger, Marlo Morgan
56. Der Fänger im Roggen, Jerome David Salinger
57. Sakrileg, Dan Brown
58. Krabat, Otfried Preußler
59. Pippi Langstrumpf, Astrid Lindgren
60. Wüstenblume, Waris Dirie
61. Geh, wohin dein Herz dich trägt, Susanna Tamaro
62. Hannas Töchter, Marianne Fredriksson
63. Mittsommermord, Henning Mankell
64. Die Rückkehr des Tanzlehrers, Henning Mankell
65. Das Hotel New Hampshire, John Irving
66. Krieg und Frieden, Leo N. Tolstoi
67. Das Glasperlenspiel, Hermann Hesse (bin irgendwann nach der Hälfte drin stecken geblieben – gute Grundidee, irgendwie zu abgehoben – und wesentlich zu lang)
68. Die Muschelsucher, Rosamunde Pilcher
69. Harry Potter und der Feuerkelch, JK Rowling
70. Tagebuch, Anne Frank (bewegend – aber weniger der Politik wegen, sondern wegen der authentisch geschilderten Pubertätsnöte, sie war der einzige Mensch, der mich verstand, als ich 14 war)
71. Salz auf unserer Haut, Benoite Groult
72. Jauche und Levkojen , Christine Brückner
73. Die Korrekturen, Jonathan Franzen (solide erzählter intellektueller Mainstream, mochte ich überhaupt nicht, hat mich teilweise regelrecht aggressiv gemacht)
74. Die weiße Massai, Corinne Hofmann
75. Was ich liebte, Siri Hustvedt
76. Die dreizehn Leben des Käpt’n Blaubär, Walter Moers
77. Das Lächeln der Fortuna, Rebecca Gablé
78. Monsieur Ibrahim und die Blumen des Koran, Eric-Emmanuel Schmitt
79. Winnetou, Karl May
80. Désirée, Annemarie Selinko
81. Nirgendwo in Afrika, Stefanie Zweig
82. Garp und wie er die Welt sah, John Irving (nach zwanzig Seiten weggelegt, konnte ich nichts mit anfangen)
83. Die Sturmhöhe, Emily Brontë
84. P.S. Ich liebe Dich, Cecilia Ahern
85. 1984, George Orwell (auch ein wichtiges, sehr aufrichtiges Buch – aber viel, viel zu politisch, ich hab irgendwann in der zweiten Hälfte aufgegeben)
86. Mondscheintarif, Ildiko von Kürthy
87. Paula, Isabel Allende
88. Solange du da bist, Marc Levy
89. Es muss nicht immer Kaviar sein, Johanns Mario Simmel
90. Veronika beschließt zu sterben, Paulo Coelho
91. Der Chronist der Winde, Henning Mankell
92. Der Meister und Margarita, Michail Bulgakow (hab ich früher über alles geliebt, als ich neulich nochmal reinlas, war es mir sehr fremd)
93. Schachnovelle, Stefan Zweig (rasant, elegant, banal – wer war das gleich, der Zweig als „Literaturfabrikant“ bezeichnete?)
94. Tadellöser & Wolff, Walter Kempowski
95. Anna Karenina, Leo N. Tolstoi
96. Schuld und Sühne, Fjodor Dostojewski
97. Der Graf von Monte Christo, Alexandre Dumas
98. Der Puppenspieler, Tanja Kinkel
99. Jane Eyre, Charlotte Brontë
100. Rote Sonne, schwarzes Land, Barbara Wood
Mein eigene Lieblingsliste folgt demnächst.
... link (8 Kommentare) ... comment
... nächste Seite