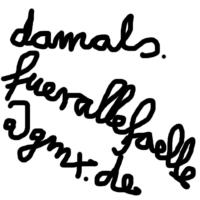Donnerstag, 17. Februar 2022
Zwei Bücher
damals, 23:25h
die ich mir zu Weihnachten gewünscht hatte: Zunächst mal "Die Rache ist mein" von Marie Ndiaye. Den Namen der Autorin hatte ich schon länger auf dem Schirm, und als jetzt die Feuilletons berichteten, dass sie einen richtigen Thriller mit Kriminalfall geschrieben hat, dachte ich, das könnte es doch sein, endlich auch mal Ndiyae zu lesen.
Das Buch war sehr spannend, es war brilliant geschrieben und es störte auch gar nicht, dass der Kriminalfall (es geht um eine Frau, die ihre Kinder tötete, um sich aus ihrer Ehe zu befreien) sich bald nur als ein beinahe nebensächlicher Anlass, in diesem Fall kann man sogar sagen: Trigger, herausstellte, um in die inneren Abgründe der Protagonistin, einer Anwältin, einzutauchen. Ein Buch, das einen fesselt: aufregend, überraschend, geradezu irre. Letzteres war allerdings auch der Punkt, der mich nach anfänglicher Faszination dann allmählich immer weiter auf Distanz gehen ließ: Die ganze Geschichte wird aus der Sicht der Protagonistin erzählt, die ständig lügt, und zwar nicht aus strategischen, sondern aus neurotischen Gründen - auch sich selbst belügt sie in einem fort. Das nervt. Natürlich kennen wir das alle: Verdrängungen, Lebenslügen, innere Abgründe - wer hat das nicht in sich? Aber in dieser Dichte, dieses Ausreden- und Lügengespinst, das war schon schwer auszuhalten.
Vielleicht ist das für kriminalistisch geschulte Leser, die Lügen schneller und mit mehr Spaß auf die Spur kommen, ein Vergnügen - mich hat es gequält. Ich bin solchen Personen zwar auch im echten Leben schon begegnet, mit einer war ich sogar einige Zeit lang befreundet, aber im echten Leben ist es irgendwie einfacher, da kann man sich darauf einstellen, indem man Tatsachenaussagen der betreffenden Person immer erstmal dahingestellt sein lässt und nur von Herz zu Herz kommuniziert. Aber in dem Roman, da musste ich ja jede freche, abstruse Lüge von vorn bis hinten durchlesen, sonst hätte ich den Handlungsfaden verloren, und ich wollte schon wissen, wie es ausgeht. Doch am Ende gabs realistischerweise keine Auflösung und nur so ein halbes Happyend, sodass ich das Buch mit einem blöden Gefühl der Antipathie verließ. Schade um so viel vergeudete Sprachkunst und erzählerische Rafinesse.
Was für ein Labsal war dagegen mein nächstes Wunschbuch, "Sie kam aus Mariupol" von Natascha Wodin! Wodin ist Romanschriftstellerin, das Buch wirkt auch wie ein Roman - es ist aber ein Sachbuch: Wodin forscht darin nach ihren familiären Wurzeln, nach der Biografie ihrer Mutter, von der sie fast nichts wusste. Denn diese Mutter hat sich mit nicht einmal 40 Jahren umgebracht, als Wodin noch ein Kind war, nachdem sie etliche Katastrophen des Jahrhunderts - Bürgerkrieg, Stalinzeit und deutsche Besatzung in der Ukraine, Zwangsarbeit und Nachkriegselend als Displaced Person in Deutschland - erlitten hatte. Wodin schreibt darüber in einer schönen, aber einfachen Sprache, deren Wucht sich aus den Inhalten, aus der Authentizität des Gesagten, speist.
Diese Authentizität geht so weit, dass das Buch je nach den zugrunde liegenden Quellen unterschiedliche stilistische Färbungen annimmt. Da ist zunächst das Hirn der Autorin selbst: ihr Bericht von der Suche, ihre Erinnerungen an die Kindheit, an ihre Mutter. Diese Passagen berühren natürlich am meisten, sie sind am persönlichsten.
Ein großer Teil des Buches fußt auf dem Lebensbericht von Wodins Tante, der älteren Schwester ihrer Mutter, die als alte Frau Erinnerungen an ihre Jugend, insbesondere die Jahre als Gulag-Häftling am berüchtigten Belomor-Kanal, verfasste, Jahre, in denen ihr ihre erzählerische Phantasie mitunter das Leben rettete. Diese Passagen wirken in Wodins Buch ein bisschen opernhaft, und ganz sicher ist das der Mentalität ihrer Tante zu verdanken.
Über die Mutter als Zwangsarbeiterin hat Wodin keinerlei biografische Angaben, sie muss sich auf entsprechende deutsche Forschungsliteratur stützen, entsprechend wird es hier ein bisschen spröde, manchmal moralisierend.
Und damit will ich gar nichts gegen die Quellen sagen, die außerordentlich glaubhaft und aufschlussreich sind. Es sind einfach unterschiedliche Techniken, die passierten monströsen Verbrechen überhaupt erzählbar, aussprechbar zu machen: indem man einen tragischen Lebensroman daraus macht wie die russische Tante - oder indem man sie als trockenen Faktenbericht mit moralischen Dekorationen darbietet wie die deutschen Forscher. Und als dritte Lesart kommt noch das Zeugnis der Autorin selbst dazu: das Leid ihres Lebens mit den riesigen biografischen Leerstellen, auch das eine Folge der Verbrechen.
Diese Vielfalt im Umgang mit dem Geschehenen macht die Größe des Buches aus. Ganz das Gegenstück zum irrwitzig in sich selbst Gefangenen von "Die Rache ist mein": wahrhaftig, differenziert, direkt - eine seltene, wohltuende Mischung.
Das Buch war sehr spannend, es war brilliant geschrieben und es störte auch gar nicht, dass der Kriminalfall (es geht um eine Frau, die ihre Kinder tötete, um sich aus ihrer Ehe zu befreien) sich bald nur als ein beinahe nebensächlicher Anlass, in diesem Fall kann man sogar sagen: Trigger, herausstellte, um in die inneren Abgründe der Protagonistin, einer Anwältin, einzutauchen. Ein Buch, das einen fesselt: aufregend, überraschend, geradezu irre. Letzteres war allerdings auch der Punkt, der mich nach anfänglicher Faszination dann allmählich immer weiter auf Distanz gehen ließ: Die ganze Geschichte wird aus der Sicht der Protagonistin erzählt, die ständig lügt, und zwar nicht aus strategischen, sondern aus neurotischen Gründen - auch sich selbst belügt sie in einem fort. Das nervt. Natürlich kennen wir das alle: Verdrängungen, Lebenslügen, innere Abgründe - wer hat das nicht in sich? Aber in dieser Dichte, dieses Ausreden- und Lügengespinst, das war schon schwer auszuhalten.
Vielleicht ist das für kriminalistisch geschulte Leser, die Lügen schneller und mit mehr Spaß auf die Spur kommen, ein Vergnügen - mich hat es gequält. Ich bin solchen Personen zwar auch im echten Leben schon begegnet, mit einer war ich sogar einige Zeit lang befreundet, aber im echten Leben ist es irgendwie einfacher, da kann man sich darauf einstellen, indem man Tatsachenaussagen der betreffenden Person immer erstmal dahingestellt sein lässt und nur von Herz zu Herz kommuniziert. Aber in dem Roman, da musste ich ja jede freche, abstruse Lüge von vorn bis hinten durchlesen, sonst hätte ich den Handlungsfaden verloren, und ich wollte schon wissen, wie es ausgeht. Doch am Ende gabs realistischerweise keine Auflösung und nur so ein halbes Happyend, sodass ich das Buch mit einem blöden Gefühl der Antipathie verließ. Schade um so viel vergeudete Sprachkunst und erzählerische Rafinesse.
Was für ein Labsal war dagegen mein nächstes Wunschbuch, "Sie kam aus Mariupol" von Natascha Wodin! Wodin ist Romanschriftstellerin, das Buch wirkt auch wie ein Roman - es ist aber ein Sachbuch: Wodin forscht darin nach ihren familiären Wurzeln, nach der Biografie ihrer Mutter, von der sie fast nichts wusste. Denn diese Mutter hat sich mit nicht einmal 40 Jahren umgebracht, als Wodin noch ein Kind war, nachdem sie etliche Katastrophen des Jahrhunderts - Bürgerkrieg, Stalinzeit und deutsche Besatzung in der Ukraine, Zwangsarbeit und Nachkriegselend als Displaced Person in Deutschland - erlitten hatte. Wodin schreibt darüber in einer schönen, aber einfachen Sprache, deren Wucht sich aus den Inhalten, aus der Authentizität des Gesagten, speist.
Diese Authentizität geht so weit, dass das Buch je nach den zugrunde liegenden Quellen unterschiedliche stilistische Färbungen annimmt. Da ist zunächst das Hirn der Autorin selbst: ihr Bericht von der Suche, ihre Erinnerungen an die Kindheit, an ihre Mutter. Diese Passagen berühren natürlich am meisten, sie sind am persönlichsten.
Ein großer Teil des Buches fußt auf dem Lebensbericht von Wodins Tante, der älteren Schwester ihrer Mutter, die als alte Frau Erinnerungen an ihre Jugend, insbesondere die Jahre als Gulag-Häftling am berüchtigten Belomor-Kanal, verfasste, Jahre, in denen ihr ihre erzählerische Phantasie mitunter das Leben rettete. Diese Passagen wirken in Wodins Buch ein bisschen opernhaft, und ganz sicher ist das der Mentalität ihrer Tante zu verdanken.
Über die Mutter als Zwangsarbeiterin hat Wodin keinerlei biografische Angaben, sie muss sich auf entsprechende deutsche Forschungsliteratur stützen, entsprechend wird es hier ein bisschen spröde, manchmal moralisierend.
Und damit will ich gar nichts gegen die Quellen sagen, die außerordentlich glaubhaft und aufschlussreich sind. Es sind einfach unterschiedliche Techniken, die passierten monströsen Verbrechen überhaupt erzählbar, aussprechbar zu machen: indem man einen tragischen Lebensroman daraus macht wie die russische Tante - oder indem man sie als trockenen Faktenbericht mit moralischen Dekorationen darbietet wie die deutschen Forscher. Und als dritte Lesart kommt noch das Zeugnis der Autorin selbst dazu: das Leid ihres Lebens mit den riesigen biografischen Leerstellen, auch das eine Folge der Verbrechen.
Diese Vielfalt im Umgang mit dem Geschehenen macht die Größe des Buches aus. Ganz das Gegenstück zum irrwitzig in sich selbst Gefangenen von "Die Rache ist mein": wahrhaftig, differenziert, direkt - eine seltene, wohltuende Mischung.
... link (0 Kommentare) ... comment
Freitag, 14. Januar 2022
Kleiner Lesetipp
damals, 19:06h
Ich habe dieser Tage einen Text gelesen, der mich bewegte, weil er im persönlichen Beispiel ein kluges Urteil über eine ganze historische Bewegung darbrachte, nämlich über die 1968er. Jetzt versteh ich besser, warum ich denen gegenüber so ambivalent reagiere, wenn sie (oder ihre Äußerungen, ihre Werke) mir begegnen. Einerseits bin ich fasziniert von ihrer anarchischen Frische, ihrem quicklebendigen Widerspruchsgeist, wie es ihn heute gar nicht mehr gibt (bzw. nur noch als Farce auf der rechten Seite und als Komödie auf der linken) und ich bin dankbar für das, was sie damit bewirkt haben - andererseits stößt mich ihre Grobheit ab, auch ihre Romantisierung ostdeutscher, osteuropäischer Ausbeutungssysteme, vor allem aber ihre feindliche Haltung gegenüber Geist und Intellekt.
... link (0 Kommentare) ... comment
Sonntag, 7. November 2021
Nichts Neues am Büchermarkt
damals, 16:02h
Es ist die tote Zeit nach dem Sonntagsfrühstück. Auf dem Fernsehbildschirm sieht man eine Kaffeemaschine und wie Kaffee in so eine Gastronomietasse rinnt. Am unteren Bildrand der Buttom "lesenswert". Damit ist mein Interesse geweckt: Ich will wissen, um welches Buch es geht.
Bald ist klar: "Glitterschnitter" von Sven Regener. Ich mag Sven Regener, hab alle seine "Herr-Lehmann"-Romane gelesen. Zwei fand ich richtig gut (bezeichnenderweise die beiden, die nicht in Kreuzberg spielen: "Neue Vahr Süd" und "Magical Mystery"), die anderen mehr oder weniger amüsant. Nur in "Glitterschnitter" bin ich kürzlich nach der Hälfte steckengeblieben und hatte keine Lust mehr weiterzulesen. Es war weniger das zunehmend Konservative, das mir schon in "Wiener Straße" nicht so recht gefiel, sondern dass ich die immergleichen Witze einfach auch mal satt hatte und außer diesen Witzen fand in "Glitterschnitter" leider rein gar nichts statt.
Denis Scheck, der Moderator von "lesenswert", dagegen outete sich als begeisterter Leser. Er traf den Autor an einem Biergartentisch in Berlin. Regener nahm große Schlucke aus seinem Weißbierglas und machte auch sonst kein Hehl aus seiner Verwurzelung in den 80er Jahren. Er schnatterte munter drauflos, amüsant und eloquent, und streute ab und zu einen klugen Gedanken ein. Scheck hatte dem nichts hinzuzufügen. Er saß in dem gewohnten, für die Situation viel zu eleganten Anzug dabei und nippte an seinem Pils. Sein Resümee: Das Buch sei "ein Fest". Offenbar leicht zufriedenzustellen, der Mann.
Dann folgte ein (in den Feuilletons viel diskutiertes) Ritual: Scheck verreißt ein einst sehr beliebtes Buch plakativ und in wenigen Worten. Diesmal traf es den "Tod eines Märchenprinzen" von Svende Merian, einen wohl etwas in die Jahre gekommenen sogenannten Frauenroman, in dem sich eine Frau einfach autobiografisch ihre Geschichte von der Seele schreibt.
Das verwunderte mich, denn gleich darauf folgte ein großes Lob für einen ebensolchen, nur halt aktuellen Frauenroman, das neue Buch von Julia Franck, "Welten auseinander". Scheck traf die Autorin in einem nostalgisch eingerichteten Café, zu dem sein Anzug dann schon besser passte. Franck trug ihr Mädchengesicht (in dem ich das ihrer Großmutter wiedererkannte) und erzählte aus ihrem Leben. Ich fand daran vor allem eins interessant: wie eindringlich sie ihr Fremdheitsgefühl (als Ossi und Ökö-Tochter) darstellte, das sie bewog, sich immer anzupassen, ganz hinter dieser Anpassung zu verschwinden. Und dieses Angepasste, ganz in der Norm Verschwindende, das zeichnet ja auch ihre Bücher aus. Scheck genoss das Gespräch sichtlich, groß in den Dialog ging ist er aber auch hier nicht, er hörte einfach zu, die einzige tiefergehende Frage (warum sie denn als Ausgereiste so problemlos zwischen Ost und West hatte pendeln können in den 80er Jahren) beantwortete sie nicht, er hakte nicht nach, sondern beendete das Gespräch mit einem Blick auf die Armbanduhr und einem väterlich-jovialen "Na".
Und ich hoffe, dass ich jetzt nicht so herablassend gegenüber Scheck agiert habe wie er gegenüber Franck. Das ist nunmal sein Job, er muss sich an dem orientieren, was auf dem Buchmarkt los ist, dann soll es auch noch irgendwie interessant und unterhaltsam sein, mit genug Feier und plakativem Verriss. Das ist auch nicht einfach, da noch eine interessante Sendung hinzubekommen, wenn rein gar nichts los ist auf dem Bestsellermarkt.
Bald ist klar: "Glitterschnitter" von Sven Regener. Ich mag Sven Regener, hab alle seine "Herr-Lehmann"-Romane gelesen. Zwei fand ich richtig gut (bezeichnenderweise die beiden, die nicht in Kreuzberg spielen: "Neue Vahr Süd" und "Magical Mystery"), die anderen mehr oder weniger amüsant. Nur in "Glitterschnitter" bin ich kürzlich nach der Hälfte steckengeblieben und hatte keine Lust mehr weiterzulesen. Es war weniger das zunehmend Konservative, das mir schon in "Wiener Straße" nicht so recht gefiel, sondern dass ich die immergleichen Witze einfach auch mal satt hatte und außer diesen Witzen fand in "Glitterschnitter" leider rein gar nichts statt.
Denis Scheck, der Moderator von "lesenswert", dagegen outete sich als begeisterter Leser. Er traf den Autor an einem Biergartentisch in Berlin. Regener nahm große Schlucke aus seinem Weißbierglas und machte auch sonst kein Hehl aus seiner Verwurzelung in den 80er Jahren. Er schnatterte munter drauflos, amüsant und eloquent, und streute ab und zu einen klugen Gedanken ein. Scheck hatte dem nichts hinzuzufügen. Er saß in dem gewohnten, für die Situation viel zu eleganten Anzug dabei und nippte an seinem Pils. Sein Resümee: Das Buch sei "ein Fest". Offenbar leicht zufriedenzustellen, der Mann.
Dann folgte ein (in den Feuilletons viel diskutiertes) Ritual: Scheck verreißt ein einst sehr beliebtes Buch plakativ und in wenigen Worten. Diesmal traf es den "Tod eines Märchenprinzen" von Svende Merian, einen wohl etwas in die Jahre gekommenen sogenannten Frauenroman, in dem sich eine Frau einfach autobiografisch ihre Geschichte von der Seele schreibt.
Das verwunderte mich, denn gleich darauf folgte ein großes Lob für einen ebensolchen, nur halt aktuellen Frauenroman, das neue Buch von Julia Franck, "Welten auseinander". Scheck traf die Autorin in einem nostalgisch eingerichteten Café, zu dem sein Anzug dann schon besser passte. Franck trug ihr Mädchengesicht (in dem ich das ihrer Großmutter wiedererkannte) und erzählte aus ihrem Leben. Ich fand daran vor allem eins interessant: wie eindringlich sie ihr Fremdheitsgefühl (als Ossi und Ökö-Tochter) darstellte, das sie bewog, sich immer anzupassen, ganz hinter dieser Anpassung zu verschwinden. Und dieses Angepasste, ganz in der Norm Verschwindende, das zeichnet ja auch ihre Bücher aus. Scheck genoss das Gespräch sichtlich, groß in den Dialog ging ist er aber auch hier nicht, er hörte einfach zu, die einzige tiefergehende Frage (warum sie denn als Ausgereiste so problemlos zwischen Ost und West hatte pendeln können in den 80er Jahren) beantwortete sie nicht, er hakte nicht nach, sondern beendete das Gespräch mit einem Blick auf die Armbanduhr und einem väterlich-jovialen "Na".
Und ich hoffe, dass ich jetzt nicht so herablassend gegenüber Scheck agiert habe wie er gegenüber Franck. Das ist nunmal sein Job, er muss sich an dem orientieren, was auf dem Buchmarkt los ist, dann soll es auch noch irgendwie interessant und unterhaltsam sein, mit genug Feier und plakativem Verriss. Das ist auch nicht einfach, da noch eine interessante Sendung hinzubekommen, wenn rein gar nichts los ist auf dem Bestsellermarkt.
... link (2 Kommentare) ... comment
Donnerstag, 29. Juli 2021
Spielfilme gucken für die Bildung?
damals, 12:14h
Ich habe endlich "Gandhi" von Richard Attenborough gesehen. War eine Idee meiner Frau: damit wir mal was zu dritt gucken können. Mein Sohn hatte nämlich ein Buch über Gandhi gelesen, das ihm sehr gefiel. Zwar liest er eigentlich nicht mehr, seit er in die Pubertät gekommen ist, aber vor 2 Jahren hat ihn mein Vater zu seinem Geburtstag in eine gut sortierte Buchhandlung geschleppt und aufgefordert, als Geschenk ein beliebiges Buch auszusuchen. Das tat er, und er las es dann auch, offenbar mit Gewinn. Anregungen nimmt er immer gern auf.
Der Gandhi-Film war dann eher mau, fanden wir alle drei. Schön anzusehen, angenehm, unterhaltsam und zumindest so fesselnd, dass die Überlänge nicht stört, aber nichts, was einen tiefer bewegt, was einem noch länger im Sinn bleibt. Mich persönlich störte vor allem die Sache mit den Moslems und der Entstehung von Pakistan, da blieben mir die Vorgänge doch viel zu sehr im Nebel.
Schade - ich hatte mir sowas wie "Schindlers Liste" erhofft. Der (also jetzt Spielbergs Film) war zwar künstlerisch viel schlechter, aber von atemberaubender historischer Präzision. Eigentlich muss man ihn als Dokumentarfilm gucken, um ihn genießen zu können.
Vielleicht sollte man Sachtexte/Sachfilme doch wieder stärker von fiktionalem Erzählen trennen. Die Illusion, man könnte sich Sachwissen gemütlich über Spielfilme/Romane erschließen, die funktioniert eben doch nicht. Ich lese gerade den neuen Gert-Loschütz-Roman "Besichtigung eines Unglücks", wieder ein sehr waches Buch, was die Beschreibung gesellschaftlicher Umstände betrifft, da kann man durchaus das eine oder andere lernen, aber das nur am Rande, das würde kein ganzes Buch rechtfertigen. Worum es im Kern geht, was einen umtreibt, noch nachdenken lässt, das ist eben etwas, das über einen Sachtext nicht erzählt werden kann. Dafür sind Spielfilme und Romane da.
Und eben das fand ich in "Gandhi" zu schwach ausgeprägt, von "Schindlers Liste" mal ganz zu schweigen.
Der Gandhi-Film war dann eher mau, fanden wir alle drei. Schön anzusehen, angenehm, unterhaltsam und zumindest so fesselnd, dass die Überlänge nicht stört, aber nichts, was einen tiefer bewegt, was einem noch länger im Sinn bleibt. Mich persönlich störte vor allem die Sache mit den Moslems und der Entstehung von Pakistan, da blieben mir die Vorgänge doch viel zu sehr im Nebel.
Schade - ich hatte mir sowas wie "Schindlers Liste" erhofft. Der (also jetzt Spielbergs Film) war zwar künstlerisch viel schlechter, aber von atemberaubender historischer Präzision. Eigentlich muss man ihn als Dokumentarfilm gucken, um ihn genießen zu können.
Vielleicht sollte man Sachtexte/Sachfilme doch wieder stärker von fiktionalem Erzählen trennen. Die Illusion, man könnte sich Sachwissen gemütlich über Spielfilme/Romane erschließen, die funktioniert eben doch nicht. Ich lese gerade den neuen Gert-Loschütz-Roman "Besichtigung eines Unglücks", wieder ein sehr waches Buch, was die Beschreibung gesellschaftlicher Umstände betrifft, da kann man durchaus das eine oder andere lernen, aber das nur am Rande, das würde kein ganzes Buch rechtfertigen. Worum es im Kern geht, was einen umtreibt, noch nachdenken lässt, das ist eben etwas, das über einen Sachtext nicht erzählt werden kann. Dafür sind Spielfilme und Romane da.
Und eben das fand ich in "Gandhi" zu schwach ausgeprägt, von "Schindlers Liste" mal ganz zu schweigen.
... link (2 Kommentare) ... comment
Donnerstag, 29. April 2021
Was soll denn das? (Shida Bazyar: Drei Kameradinnen)
damals, 00:18h
Es kommt selten vor, dass ich so schnell bin und mir tatsächlich einen soeben erschienenen Roman kaufe. Aber der Zufall wollte es, dass ich vor ein paar Wochen Bazyars Debüt "Nachts ist es leise in Teheran" gelesen habe, ein wunderbares Buch, und da will man dann das nächste natürlich auch haben. In diesem wunderbaren Buch, der Geschichte einer Flüchtlingsfamilie aus dem Iran in Deutschland aus verschiedenen Perspektiven, da fand ich wiederum ein Kapitel besonders anrührend, das handelt vom Sohn Mo und seinen Erlebnissen in der deutschen Studentenwelt. Das wirkt auf den ersten Blick etwas oberflächlich mit seinem studentischen Plaudertonfall, aber man spürt doch genau die Verlorenheit des jungen Menschen, aber auch seine Wachheit, sein Gespür für das, was in dieser Studentenwelt nicht stimmt. Natürlich funktioniert das nur im Gesamtzusammenhang des Romans, weil man seinen Hintergrund kennt und weiß, warum er verloren wirkt, und auch, woher sein kritischer Geist stammt.
Ich erwähne das, weil der neue Roman in demselben Tonfall gehalten ist, von drei jungen Frauen erzählt, von ihren Gesprächen, ihren Sehnsüchten, ihren Besäufnissen, allerdings bewusst die biografischen Hintergründe der Figuren verschweigt, abgesehen von der Tatsache, dass sie nicht biodeutsch sind. Das ist schon mutig von der Autorin, die Erzählerin da so 300 Seiten lang schwadronieren zu lassen, inklusive Nörgeleien und Flunkereien, Klischees und Vorurteilen, Wut und Aggressionen. Also, ich hätte das Buch bestimmt nach der Hälfte weggelegt, hätte nicht der etwas dick aufgetragene Suspense-Effekt - mehrfach wird angedeutet, dass am Ende die Sache mit dem Brand und mit der Verhaftung aufgeklärt wird - letztendlich doch funktioniert: Ich wollte einfach wissen, wie's ausgeht, und raste weiter durchs Buch, wobei mir das, was unterwegs als Handlung passierte, immer mehr egal wurde.
Und dann, wie gesagt nach 300 Seiten, da sagt die Erzählerin plötzlich: Natürlich alles Quatsch, was ich hier erzähle, aber da seht ihr mal, wie das ist, wenn man so ständig mit Klischees und Vorurteilen bombardiert wird als Nicht-Weiße. Da hat sie sicher Recht. Ich frage mich bloß, welchen Sinn das haben soll, das 1:1 zu spiegeln und damit die Menge der Vorurteile zu verdoppeln. Und vor allem frage ich mich, was die Autorin sich davon verspricht. Denn Leser gewinnt man auf diese Weise nicht - oder schlimmer noch: Man gewinnt nur Leser, die die Wahrheit im Grunde nicht hören wollen, sondern sich lieber an Nörgeleien, Klischees und Vorurteilen ergötzen.
Vor allem aber ärgerte mich eins: In dem Buch gibt es viele kleine Episoden, gut und eindringlich erzählte Episoden, die am konkreten Beispiel erfahrbar machen, wie Diskriminierung funktioniert. Diese Episoden hätten es verdient, zum Leuchten gebracht zu werden, in einem direkten, deutlichen, ehrlichen Buch. So - verwoben in ein Netz aus Banalität und Missgunst - verlieren sie einiges an Glaubhaftigkeit. Und das ist schade.
Vielleicht bin ich auch nur für diese Sorte Humor zu ehrpusselig.
Ich erwähne das, weil der neue Roman in demselben Tonfall gehalten ist, von drei jungen Frauen erzählt, von ihren Gesprächen, ihren Sehnsüchten, ihren Besäufnissen, allerdings bewusst die biografischen Hintergründe der Figuren verschweigt, abgesehen von der Tatsache, dass sie nicht biodeutsch sind. Das ist schon mutig von der Autorin, die Erzählerin da so 300 Seiten lang schwadronieren zu lassen, inklusive Nörgeleien und Flunkereien, Klischees und Vorurteilen, Wut und Aggressionen. Also, ich hätte das Buch bestimmt nach der Hälfte weggelegt, hätte nicht der etwas dick aufgetragene Suspense-Effekt - mehrfach wird angedeutet, dass am Ende die Sache mit dem Brand und mit der Verhaftung aufgeklärt wird - letztendlich doch funktioniert: Ich wollte einfach wissen, wie's ausgeht, und raste weiter durchs Buch, wobei mir das, was unterwegs als Handlung passierte, immer mehr egal wurde.
Und dann, wie gesagt nach 300 Seiten, da sagt die Erzählerin plötzlich: Natürlich alles Quatsch, was ich hier erzähle, aber da seht ihr mal, wie das ist, wenn man so ständig mit Klischees und Vorurteilen bombardiert wird als Nicht-Weiße. Da hat sie sicher Recht. Ich frage mich bloß, welchen Sinn das haben soll, das 1:1 zu spiegeln und damit die Menge der Vorurteile zu verdoppeln. Und vor allem frage ich mich, was die Autorin sich davon verspricht. Denn Leser gewinnt man auf diese Weise nicht - oder schlimmer noch: Man gewinnt nur Leser, die die Wahrheit im Grunde nicht hören wollen, sondern sich lieber an Nörgeleien, Klischees und Vorurteilen ergötzen.
Vor allem aber ärgerte mich eins: In dem Buch gibt es viele kleine Episoden, gut und eindringlich erzählte Episoden, die am konkreten Beispiel erfahrbar machen, wie Diskriminierung funktioniert. Diese Episoden hätten es verdient, zum Leuchten gebracht zu werden, in einem direkten, deutlichen, ehrlichen Buch. So - verwoben in ein Netz aus Banalität und Missgunst - verlieren sie einiges an Glaubhaftigkeit. Und das ist schade.
Vielleicht bin ich auch nur für diese Sorte Humor zu ehrpusselig.
... link (3 Kommentare) ... comment
Montag, 12. April 2021
Verriss des Verrisses
damals, 20:19h
Das wird ja ein reines Nörgelblog hier, und wenn ich mal was richtig Schönes erlebt habe, dann kommt mir das erst dann zu Bewusstsein, wenn ich mich im Zusammenhang damit über etwas aufregen kann.
Und zwar über Denis Scheck mal wieder. Scheck ist wunderbar, wenn er sich im bildungsbürgerlichen Literatur-Diskurs so richtig wohlfühlen kann. Ich habe ihn vor einem Jahr live erlebt, im Gespräch mit Heinrich Steinfest, da ging es um Grunde um nichts: um Gedankenspielereien, um Verrücktheiten bei Sinneswahrnehmungen, die beiden klugen Männer warfen sich die Bälle zu - es war eine wahre Freude!
Aber schick Denis Scheck mal in ein Gebiet, in dem sich nicht auskennt - das wird nix. Als er den "Turm" des Emporkömmlings Tellkamp rezensieren sollte, der seine Wahrhaftigkeiten zwischen überangepasstem Kitsch, zwischen Über- und Untertreibungen versteckt, da hat sich der Bürger Scheck gar nicht erst auf die Suche begeben, da fand er, dass das "nach Schweiß" stinkt, und wandte sich naserümpfend ab.
Und jetzt lese ich hier, dass er dort behauptet hat, Deniz Ohde könne nicht denken, ihr fehle jede Intellektualität. Tja, was sagt man dazu? Na ja, so denken wie Denis Scheck, das kann sie wahrscheinlich nicht, sie kommt ja auch aus einem ganz anderem Milieu - aber hingucken, vorurteilsfrei und differenziert hingucken, das kann sie, im Gegensatz zu Scheck. Da kann er sich eine Scheibe abschneiden.
Na ja, vielleicht ist es nicht nur das. Vielleicht ist es auch eine bestimmte psychische Disposition. Wie anders wäre es erklärbar, dass ich, der ich keine Türkin bin und auch nicht aus der Unterschicht komme, dass ich "Streulicht", ihren Debütroman, so identifizierend lesen, ja verschlingen konnte, dass ich in jeder Zeile verstanden habe und mich verstanden fühlte, dass ich - so irrational das ist - beim Lesen eine Genugtuung empfand, dass mal eine von uns auf die Bestsellerlisten klettert? Und mich einfach nur freute, freute?
Oder ist es im Grunde viel einfacher und Deniz Ohde kann einfach nur richtig gut schreiben?
Und zwar über Denis Scheck mal wieder. Scheck ist wunderbar, wenn er sich im bildungsbürgerlichen Literatur-Diskurs so richtig wohlfühlen kann. Ich habe ihn vor einem Jahr live erlebt, im Gespräch mit Heinrich Steinfest, da ging es um Grunde um nichts: um Gedankenspielereien, um Verrücktheiten bei Sinneswahrnehmungen, die beiden klugen Männer warfen sich die Bälle zu - es war eine wahre Freude!
Aber schick Denis Scheck mal in ein Gebiet, in dem sich nicht auskennt - das wird nix. Als er den "Turm" des Emporkömmlings Tellkamp rezensieren sollte, der seine Wahrhaftigkeiten zwischen überangepasstem Kitsch, zwischen Über- und Untertreibungen versteckt, da hat sich der Bürger Scheck gar nicht erst auf die Suche begeben, da fand er, dass das "nach Schweiß" stinkt, und wandte sich naserümpfend ab.
Und jetzt lese ich hier, dass er dort behauptet hat, Deniz Ohde könne nicht denken, ihr fehle jede Intellektualität. Tja, was sagt man dazu? Na ja, so denken wie Denis Scheck, das kann sie wahrscheinlich nicht, sie kommt ja auch aus einem ganz anderem Milieu - aber hingucken, vorurteilsfrei und differenziert hingucken, das kann sie, im Gegensatz zu Scheck. Da kann er sich eine Scheibe abschneiden.
Na ja, vielleicht ist es nicht nur das. Vielleicht ist es auch eine bestimmte psychische Disposition. Wie anders wäre es erklärbar, dass ich, der ich keine Türkin bin und auch nicht aus der Unterschicht komme, dass ich "Streulicht", ihren Debütroman, so identifizierend lesen, ja verschlingen konnte, dass ich in jeder Zeile verstanden habe und mich verstanden fühlte, dass ich - so irrational das ist - beim Lesen eine Genugtuung empfand, dass mal eine von uns auf die Bestsellerlisten klettert? Und mich einfach nur freute, freute?
Oder ist es im Grunde viel einfacher und Deniz Ohde kann einfach nur richtig gut schreiben?
... link (1 Kommentar) ... comment
Samstag, 20. Februar 2021
Unsensibel
damals, 11:06h
Gestern bin ich kurz vor acht vom Familienabendbrotstisch aufgesprungen, um schnell den 20.15-Uhr-Film auf arte zu programmieren, den ich später noch gucken wollte.
Der Film selber war ganz gut gemacht und von Anfang an schön spannend, er fußte aber auf einer derart billigen antiislamischen Ideologie, dass ich nach einer halben Stunde genervt ausschaltete. Das war so weit okay und völlig normal - schließlich fußen die allermeisten Thriller auf irgendeiner billigen Ideologie, nur selten ist einer dabei, den ich mit Spaß zuendegucke. Und mit meinem Roman im Bett, wo auch meine Frau vor sich hin schmökerte, da wars auch ganz nett.
Nur hinterher, da fragte ich mich, ob das wirklich sein muss, an so einem Tag, an dem andere der Opfer von Hanau gedenken, da um 20.15 Uhr so einen Film zu zeigen. Man zeigt doch auch nicht "Das Leben des Bryan" am Heiligen Abend oder "Inglorious Basterds" am Tag des Holocaust-Gedenkens.
Der Film selber war ganz gut gemacht und von Anfang an schön spannend, er fußte aber auf einer derart billigen antiislamischen Ideologie, dass ich nach einer halben Stunde genervt ausschaltete. Das war so weit okay und völlig normal - schließlich fußen die allermeisten Thriller auf irgendeiner billigen Ideologie, nur selten ist einer dabei, den ich mit Spaß zuendegucke. Und mit meinem Roman im Bett, wo auch meine Frau vor sich hin schmökerte, da wars auch ganz nett.
Nur hinterher, da fragte ich mich, ob das wirklich sein muss, an so einem Tag, an dem andere der Opfer von Hanau gedenken, da um 20.15 Uhr so einen Film zu zeigen. Man zeigt doch auch nicht "Das Leben des Bryan" am Heiligen Abend oder "Inglorious Basterds" am Tag des Holocaust-Gedenkens.
... link (7 Kommentare) ... comment
Freitag, 15. Januar 2021
nd, der alte Nörgler ...
damals, 20:10h
… wie auch sonst manchmal – wenn man mal vornehm über seine Neigung zu Pathos und Übertreibung hinwegsieht - hat er auch hier völlig Recht: Sofern Sie irgendwo in Ihrer Umgebung ein Netflix-Abo nutzen können – gucken Sie diese Serie!
(Und wenn ich mir was wünschen dürfte: dann eine deutsche Serie über kulturelle Konflikte in Deutschland, die ebenso klug, differenziert und menschlich bewegend ist wie „Bir Baskadir - Acht Menschen in Istanbul“.)
(Und wenn ich mir was wünschen dürfte: dann eine deutsche Serie über kulturelle Konflikte in Deutschland, die ebenso klug, differenziert und menschlich bewegend ist wie „Bir Baskadir - Acht Menschen in Istanbul“.)
... link (0 Kommentare) ... comment
Freitag, 18. Dezember 2020
Kritik der Kritiken
damals, 16:32h
Meine Fernsehzeitschrift mochte ich schon immer, seit es sie gibt, weil sie so schöne Kurzkritiken schreibt. Besonders die Verrisse machen Spaß. Die hohe Kunst aber sind die Lobeshymnen, die aus markttechnischen Gründen als „Tipp des Tages“ verkauft werden müssen, obwohl sie von minderer Qualität sind. Wie uns da zwischen den Zeilen die Wahrheit mitgeteilt wird, das finde ich immer wieder elegant.
Hier zwei aktuelle Beispiele: „Mit aufdringlich heiterer Musik untermalt … drohen ‚Die Weihnachtstöchter‘ anfangs zielsicher ins Kitschige zu steuern. Doch dank der drei tollen Protagonistinnen … pendelt sich der Film … ein. Das Ende mag dann zwar nicht zu überraschen, doch der Weg dahin ist unterhaltsam anzusehen.“
Oder (Beispiel 2): „Herfurths … Regiedebüt ist eine … Liebesgeschichte, die … immer den richtigen Ton trifft, bevor es ein wenig kitschig wird. Die Besetzung ist perfekt …, am Drehbuch schrieb auch Til Schweigers ‚Keinohrhasen‘-Autorin Anika Decker mit. Irgendwie hätte man Karoline Herfurth zwar einen etwas persönlicheren Film für ihr Debüt hinter der Kamera gewünscht. Andererseits: Was könnte persönlicher sein als die Liebe?“
Besonders diesen Schlusssatz finde ich genial: Denn natürlich weiß sich der Kritik-Autor mit dem Leser einig, dass es in TV-Plots kaum etwas Unpersönlicheres, Klischeehafteres gibt als „die Liebe“. So wird dem Leser deutlich mitgeteilt, dass es sich bei beiden „Tipps des Tages“ um schlechte Filme handelt, es wird bei genauerem Lesen sogar deutlich, dass das erste Beispiel wahrscheinlich noch einigermaßen erträglich, das zweite aber ein völliges No-Go ist.
Und das nicht etwa, weil ich TV-Banalität grundsätzlich ablehnen würde – ganz im Gegenteil. Ich gucke ganz gern mal am Abend eine nette, belanglose Geschichte zur Unterhaltung, auch Liebe darf mit dabei sein. Solche Filme werden aber von meiner Zeitschrift wie folgt annonciert: „Voller Gefühl und erstaunlich kitscharm zeigt Austro-Argentinierin Catalina Molina, was im Leben wirklich zählt.“
P.S. Ich hab das jetzt ganz wertfrei ohne Ansehen der Person, d.h. des jeweiligen Films geschrieben. Beispiel 1 und 2 werd ich mir natürlich nicht ansehen, Nr. 3 wartet auf der Festplatte auf einen passenden, gemütlich-gelangweilten Abend.
Hier zwei aktuelle Beispiele: „Mit aufdringlich heiterer Musik untermalt … drohen ‚Die Weihnachtstöchter‘ anfangs zielsicher ins Kitschige zu steuern. Doch dank der drei tollen Protagonistinnen … pendelt sich der Film … ein. Das Ende mag dann zwar nicht zu überraschen, doch der Weg dahin ist unterhaltsam anzusehen.“
Oder (Beispiel 2): „Herfurths … Regiedebüt ist eine … Liebesgeschichte, die … immer den richtigen Ton trifft, bevor es ein wenig kitschig wird. Die Besetzung ist perfekt …, am Drehbuch schrieb auch Til Schweigers ‚Keinohrhasen‘-Autorin Anika Decker mit. Irgendwie hätte man Karoline Herfurth zwar einen etwas persönlicheren Film für ihr Debüt hinter der Kamera gewünscht. Andererseits: Was könnte persönlicher sein als die Liebe?“
Besonders diesen Schlusssatz finde ich genial: Denn natürlich weiß sich der Kritik-Autor mit dem Leser einig, dass es in TV-Plots kaum etwas Unpersönlicheres, Klischeehafteres gibt als „die Liebe“. So wird dem Leser deutlich mitgeteilt, dass es sich bei beiden „Tipps des Tages“ um schlechte Filme handelt, es wird bei genauerem Lesen sogar deutlich, dass das erste Beispiel wahrscheinlich noch einigermaßen erträglich, das zweite aber ein völliges No-Go ist.
Und das nicht etwa, weil ich TV-Banalität grundsätzlich ablehnen würde – ganz im Gegenteil. Ich gucke ganz gern mal am Abend eine nette, belanglose Geschichte zur Unterhaltung, auch Liebe darf mit dabei sein. Solche Filme werden aber von meiner Zeitschrift wie folgt annonciert: „Voller Gefühl und erstaunlich kitscharm zeigt Austro-Argentinierin Catalina Molina, was im Leben wirklich zählt.“
P.S. Ich hab das jetzt ganz wertfrei ohne Ansehen der Person, d.h. des jeweiligen Films geschrieben. Beispiel 1 und 2 werd ich mir natürlich nicht ansehen, Nr. 3 wartet auf der Festplatte auf einen passenden, gemütlich-gelangweilten Abend.
... link (0 Kommentare) ... comment
Samstag, 28. November 2020
Trübe Tage
damals, 16:50h
(Vorsicht: Das ist nur wieder eine Sammelrezension des in den letzten Monaten konsumierten Medienwusts - scrollen Sie einfach kurz durch, ob was für Sie Interessantes dabei ist.)
Es ist grad eine stressige Zeit. Dabei sind die Einschränkungen durch die Pandemie nur nur das i-Tüpfelchen. Aber davon will ich nicht reden, verkriech mich lieber in die Medien. Dabei hab ich nicht mal ein ordentliches Buch zur Hand! Das letzte vernünftige, das ich in den Fingern hatte - „Das letzte Jahr“ von Martin Groß – das hab ich nun auch schon seit ein paar Wochen ausgelesen. Immerhin hat es mir mit seiner stillen Größe so einige trübe Herbstabende vergoldet (um mit Th. Storm zu sprechen). Ich werd es sicher nochmal zur Hand nehmen, wenn ich besser drauf bin – kluge Bücher haben ein zweites Mal verdient.
Also lese ich, was sich sonst so an Büchern angesammelt hat. Aber es ist nichts: „In Plüschgewittern“, berühmtes Buch, fand ich neulich in einem Verschenke-Karton in unserer Straße - ein grässliches Buch, ich gab nach ca. einem Drittel auf: Es erinnert mich an das furchtbare „Faserland“; auch wenn es etwas schöner geschrieben ist, so geht mir doch diese nörgelige, männlich-egozentrische Ichlosigkeit mit ihrem Hass auf alles, was schön ist, ziemlich auf die Nerven.
Na, dann eben die zwei Heinrich-Steinfest-Romane, die meine Schwester bei mir entsorgt hat: „Kannst du damit was anfangen?“ Von Steinfest hab ich ja immerhin mit großem Spaß „Der Allesforscher“ und „Das grüne Rollo“ gelesen, also warum nicht? „Die Büglerin“ griff ich mir zuerst, weil so ein gebundenes Buch mit elegantem Schutzumschlag ja zum Zugreifen verleitet. Leider ein völlig hohles Buch, wenn auch sehr geistreich und elegant geschrieben (viele schöne Bonmots und sprachliche Einfälle) und mit einer ordentlichen und abwechslungsreichen Romanhandlung versehen, sodass ich es dann doch zuende gelesen habe. Aber insgesamt hat sich für mich daraus kein Sinn erschlossen, sodass ich es am Ende mit einem ziemlich flauen Gefühl zuklappte. Und dann das überdicke Taschenbuch „Das Leben und Sterben der Flugzeuge“, das war äußerst witzig, aber sinnloser Unfug (oder wie würden Sie das nennen, wenn ein Spatz! seinen Tag mit den Worten „Die Zeit verging, der Mittag drehte sich wie eine Schraube in den Nachmittag und machte ihn fest.“ beschreibt) – darüber schmunzelt man 30 Seiten lang, danach reichts einem.
Also Fernsehen: Aber da kommt ja rein gar nichts, wenn man den Ankündigungen von TVSp**** glauben darf, die kürzlich wieder mal die Anzahl ihrer Spielfilmkritiken reduziert hat, um sich dem Schrott-Niveau ihrer FS-Zeitungs-Konkurrentinnen anzupassen – ich glaube, ich habe seit Monaten keinen Film mehr gesehen, der nicht auf arte lief.
Zum Glück sorgt die nächste Generation für Innovationen: Mein Sohn finanziert von seinem Taschengeld ein Netflix-Abo, ich dachte erst, das ist nichts für mich (aus reiner Neugier hab ich mal eine Folge von „Braking Bad“ mitgeguckt, ich fand das völlig abstrus und auch nicht witzig – als mein Sohn versuchte, mir die Sache durch eine Einführung in die größere Handlungslogik schmackhaft zu machen, glaubte ich immerhin zu verstehen, dass das wohl wie so eine Art Schachspiel funktioniert, wo ja menschliche Beziehungslogik und psychologische Wahrscheinlichkeit ebenfalls keine Rolle spielen) – jetzt hab ich zum ersten Mal seit Lars von Triers „Geistern“ (und das war damals in den 90ern!) eine ganze Serienstaffel durchgehalten und mich durchaus amüsiert: „Das letzte Wort“ von und mit Thorsten Merten (den ich seit „Stilles Land“ ja mag und gerne sehe) und Anke Engelke. Das ist wirklich lustig.
Gestern Abend hab ich dann zum Wochenende mal „Netflix Arthouse“ gegoogelt und tatsächliche einige Angebote bekommen. Ich entschied mich für "Atlantique“, einen in Cannes prämierten Film aus dem Senegal: Der war von Beginn an schön langsam und emotional intensiv, danach noch mit einer etwas seltsamen typisch westafrikanischen Geistergeschichte. Das war schonmal was.
Und heute morgen les ich auf taz.de von einer türkischen Netflix-Serie, die interessant klang: „Bir Baskadir – Acht Menschen in Istanbul“. Ich sah mir gleich die erste Folge an und war gleich zu Tränen gerührt. Das traf meinen Nerv, ich werd gleich die nächste Folge gucken. Denn die Welt da draußen, so schön sie optisch ist,

beginnt schon wieder im Dunkel zu versinken.
Es ist grad eine stressige Zeit. Dabei sind die Einschränkungen durch die Pandemie nur nur das i-Tüpfelchen. Aber davon will ich nicht reden, verkriech mich lieber in die Medien. Dabei hab ich nicht mal ein ordentliches Buch zur Hand! Das letzte vernünftige, das ich in den Fingern hatte - „Das letzte Jahr“ von Martin Groß – das hab ich nun auch schon seit ein paar Wochen ausgelesen. Immerhin hat es mir mit seiner stillen Größe so einige trübe Herbstabende vergoldet (um mit Th. Storm zu sprechen). Ich werd es sicher nochmal zur Hand nehmen, wenn ich besser drauf bin – kluge Bücher haben ein zweites Mal verdient.
Also lese ich, was sich sonst so an Büchern angesammelt hat. Aber es ist nichts: „In Plüschgewittern“, berühmtes Buch, fand ich neulich in einem Verschenke-Karton in unserer Straße - ein grässliches Buch, ich gab nach ca. einem Drittel auf: Es erinnert mich an das furchtbare „Faserland“; auch wenn es etwas schöner geschrieben ist, so geht mir doch diese nörgelige, männlich-egozentrische Ichlosigkeit mit ihrem Hass auf alles, was schön ist, ziemlich auf die Nerven.
Na, dann eben die zwei Heinrich-Steinfest-Romane, die meine Schwester bei mir entsorgt hat: „Kannst du damit was anfangen?“ Von Steinfest hab ich ja immerhin mit großem Spaß „Der Allesforscher“ und „Das grüne Rollo“ gelesen, also warum nicht? „Die Büglerin“ griff ich mir zuerst, weil so ein gebundenes Buch mit elegantem Schutzumschlag ja zum Zugreifen verleitet. Leider ein völlig hohles Buch, wenn auch sehr geistreich und elegant geschrieben (viele schöne Bonmots und sprachliche Einfälle) und mit einer ordentlichen und abwechslungsreichen Romanhandlung versehen, sodass ich es dann doch zuende gelesen habe. Aber insgesamt hat sich für mich daraus kein Sinn erschlossen, sodass ich es am Ende mit einem ziemlich flauen Gefühl zuklappte. Und dann das überdicke Taschenbuch „Das Leben und Sterben der Flugzeuge“, das war äußerst witzig, aber sinnloser Unfug (oder wie würden Sie das nennen, wenn ein Spatz! seinen Tag mit den Worten „Die Zeit verging, der Mittag drehte sich wie eine Schraube in den Nachmittag und machte ihn fest.“ beschreibt) – darüber schmunzelt man 30 Seiten lang, danach reichts einem.
Also Fernsehen: Aber da kommt ja rein gar nichts, wenn man den Ankündigungen von TVSp**** glauben darf, die kürzlich wieder mal die Anzahl ihrer Spielfilmkritiken reduziert hat, um sich dem Schrott-Niveau ihrer FS-Zeitungs-Konkurrentinnen anzupassen – ich glaube, ich habe seit Monaten keinen Film mehr gesehen, der nicht auf arte lief.
Zum Glück sorgt die nächste Generation für Innovationen: Mein Sohn finanziert von seinem Taschengeld ein Netflix-Abo, ich dachte erst, das ist nichts für mich (aus reiner Neugier hab ich mal eine Folge von „Braking Bad“ mitgeguckt, ich fand das völlig abstrus und auch nicht witzig – als mein Sohn versuchte, mir die Sache durch eine Einführung in die größere Handlungslogik schmackhaft zu machen, glaubte ich immerhin zu verstehen, dass das wohl wie so eine Art Schachspiel funktioniert, wo ja menschliche Beziehungslogik und psychologische Wahrscheinlichkeit ebenfalls keine Rolle spielen) – jetzt hab ich zum ersten Mal seit Lars von Triers „Geistern“ (und das war damals in den 90ern!) eine ganze Serienstaffel durchgehalten und mich durchaus amüsiert: „Das letzte Wort“ von und mit Thorsten Merten (den ich seit „Stilles Land“ ja mag und gerne sehe) und Anke Engelke. Das ist wirklich lustig.
Gestern Abend hab ich dann zum Wochenende mal „Netflix Arthouse“ gegoogelt und tatsächliche einige Angebote bekommen. Ich entschied mich für "Atlantique“, einen in Cannes prämierten Film aus dem Senegal: Der war von Beginn an schön langsam und emotional intensiv, danach noch mit einer etwas seltsamen typisch westafrikanischen Geistergeschichte. Das war schonmal was.
Und heute morgen les ich auf taz.de von einer türkischen Netflix-Serie, die interessant klang: „Bir Baskadir – Acht Menschen in Istanbul“. Ich sah mir gleich die erste Folge an und war gleich zu Tränen gerührt. Das traf meinen Nerv, ich werd gleich die nächste Folge gucken. Denn die Welt da draußen, so schön sie optisch ist,

beginnt schon wieder im Dunkel zu versinken.
... link (0 Kommentare) ... comment
... nächste Seite