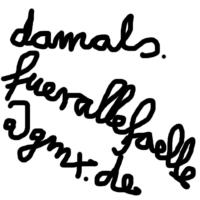Dienstag, 24. März 2009
Hans Erich Nossack: "Der Untergang" (1943)
damals, 01:18h
Der Ton macht die Musik nicht und „Le style c'est l`homme“ – das stimmt auch nicht. Was ich da nämlich auf dem Bücherflohmarkt unserer Gemeinde fand und mit nach Hause trug (neben Christa Wolfs „Leibhaftig“, Jurek Beckers „Jakob der Lügner“ und einem Schulbuch über die Hamburger Sturmflut von 1962), das klang, als ich anfing, es zu lesen, so verstaubt und ultrakonservativ wie Ernst von Salomon, der dort auch auf jedem der Wühltische umherlag. Aber war es nicht.
Sondern ein spannender autobiografischer Bericht von mitreißender Authentizität. Nossacks Frau hatte ein Häuschen, wohl eher eine Hütte, gemietet für vierzehn Tage, in der Heide südlich Hamburgs, und der Autor selber war ihr gefolgt. Drei Tage später fielen die Bomben, ein paar Tage und Nächte lang, Nossack sah sie am Nachthimmel heranfliegen und erfuhr kurze Zeit später, als die ersten Flüchtlinge den Ort erreichten, dass auch sein Haus nicht mehr stehen würde. Nach einigem Zögern entschließt sich das Ehepaar Nossack, nach Hamburg zu fahren. Sie besichtigen die Reste des Büros (Nossack hatte die kleine Importfirma seines Vaters geleitet) sowie ihre Straße, wo ihr Haus tatsächlich nicht mehr vorhanden ist – und auch der im Nachbarkeller verwahrte Koffer bereits gestohlen.
So weit die Handlung des Textes. Was den Stil betrifft, hatte ich anfangs wie gesagt meine Schwierigkeiten: Vom „Auftrag“, etwas zu schreiben, wurde da geredet, vom Schicksal geraunt und viel mystisch um die Sachen herumgeredet, wie man das in den dreißiger/vierziger Jahren eben so machte. Denn der Text ist Ende 1943 entstanden, ein halbes Jahr nach den Ereignissen. Ja, aber so ist das eben, das wurde mir schnell klar: Wer in seiner Zeit lebt und lebendig ist, der redet auch im Stil seiner Zeit, wenn er nicht völlig abgedreht ist. Und was mich beeindruckte: dass dieser Autor, der stilistisch ganz zeitbefangen ist (nenn es Nazistil, nenn es prä-existenzialistisch, nenn es Mystizismus – ganz egal), politisch so frei ist, wie man es nur sein kann, wenn man sich seiner Zeit nicht verweigert. (Und er war Kommunist, wie ich später bei Wikipedia nachlas, er hätte das Recht gehabt, politisch rumzumotzen.)
Aber er tut es nicht. Wer zum Beispiel an diesem Krieg Schuld ist, macht er nicht zum Thema. Ideologie ist nicht seine Sache. Er sieht die Bomber, er sieht das Unrecht und er benennt es. Und die Wenigen, die neben ihm stehen und abgeschossene Bomber bejubeln, für die hat er nur kopfschüttelnde Verachtung. Morden ist Unrecht, so oder so.
Insofern hat er mit seinem Schicksalraunen ja sogar auch Recht: Ein solcher Krieg bedeutet den Untergang der Zivilisation. Wir viel später Geborenen wissen ganz selbstverständlich, dass in diesen Jahren die Moderne untergegangen ist – und dass seitdem die August-Macke-Bilder nur noch als Kitsch-Objekte möglich sind und „Berlin Alexanderplatz“ keinen Menschen mehr aufregt. Aber er sah es schon im Moment des Geschehens.
Ergreifend an dieser Geschichte ist auch, dass Nossack diesen Untergang als Befreiung erlebt. Da gehört schon einige Größe dazu: Ein verbotener, erfolgloser Schriftsteller, dem der schriftliche Ertrag von Jahren, Jahrzehnten soeben verbrannt ist: der fühlt sich befreit. Und der fühlt, wie die Ordnungsmacht, die diktatorische Ordnungsmacht, nach dem ersten Schock schon wieder zu dirigieren versucht: die Flüchtlingsmassen kanalisiert, die zerbombten Stadtteile absperrt – und er beschließt, mit Hilfe seiner heimatliebenden Frau, nicht Flüchtling zu werden, sich nicht aufzugeben, sondern zurückzukehren in die zerstörte Stadt, die sein Zuhause ist.
So möchte man leben. Ist mir ein Vorbild.
Sondern ein spannender autobiografischer Bericht von mitreißender Authentizität. Nossacks Frau hatte ein Häuschen, wohl eher eine Hütte, gemietet für vierzehn Tage, in der Heide südlich Hamburgs, und der Autor selber war ihr gefolgt. Drei Tage später fielen die Bomben, ein paar Tage und Nächte lang, Nossack sah sie am Nachthimmel heranfliegen und erfuhr kurze Zeit später, als die ersten Flüchtlinge den Ort erreichten, dass auch sein Haus nicht mehr stehen würde. Nach einigem Zögern entschließt sich das Ehepaar Nossack, nach Hamburg zu fahren. Sie besichtigen die Reste des Büros (Nossack hatte die kleine Importfirma seines Vaters geleitet) sowie ihre Straße, wo ihr Haus tatsächlich nicht mehr vorhanden ist – und auch der im Nachbarkeller verwahrte Koffer bereits gestohlen.
So weit die Handlung des Textes. Was den Stil betrifft, hatte ich anfangs wie gesagt meine Schwierigkeiten: Vom „Auftrag“, etwas zu schreiben, wurde da geredet, vom Schicksal geraunt und viel mystisch um die Sachen herumgeredet, wie man das in den dreißiger/vierziger Jahren eben so machte. Denn der Text ist Ende 1943 entstanden, ein halbes Jahr nach den Ereignissen. Ja, aber so ist das eben, das wurde mir schnell klar: Wer in seiner Zeit lebt und lebendig ist, der redet auch im Stil seiner Zeit, wenn er nicht völlig abgedreht ist. Und was mich beeindruckte: dass dieser Autor, der stilistisch ganz zeitbefangen ist (nenn es Nazistil, nenn es prä-existenzialistisch, nenn es Mystizismus – ganz egal), politisch so frei ist, wie man es nur sein kann, wenn man sich seiner Zeit nicht verweigert. (Und er war Kommunist, wie ich später bei Wikipedia nachlas, er hätte das Recht gehabt, politisch rumzumotzen.)
Aber er tut es nicht. Wer zum Beispiel an diesem Krieg Schuld ist, macht er nicht zum Thema. Ideologie ist nicht seine Sache. Er sieht die Bomber, er sieht das Unrecht und er benennt es. Und die Wenigen, die neben ihm stehen und abgeschossene Bomber bejubeln, für die hat er nur kopfschüttelnde Verachtung. Morden ist Unrecht, so oder so.
Insofern hat er mit seinem Schicksalraunen ja sogar auch Recht: Ein solcher Krieg bedeutet den Untergang der Zivilisation. Wir viel später Geborenen wissen ganz selbstverständlich, dass in diesen Jahren die Moderne untergegangen ist – und dass seitdem die August-Macke-Bilder nur noch als Kitsch-Objekte möglich sind und „Berlin Alexanderplatz“ keinen Menschen mehr aufregt. Aber er sah es schon im Moment des Geschehens.
Ergreifend an dieser Geschichte ist auch, dass Nossack diesen Untergang als Befreiung erlebt. Da gehört schon einige Größe dazu: Ein verbotener, erfolgloser Schriftsteller, dem der schriftliche Ertrag von Jahren, Jahrzehnten soeben verbrannt ist: der fühlt sich befreit. Und der fühlt, wie die Ordnungsmacht, die diktatorische Ordnungsmacht, nach dem ersten Schock schon wieder zu dirigieren versucht: die Flüchtlingsmassen kanalisiert, die zerbombten Stadtteile absperrt – und er beschließt, mit Hilfe seiner heimatliebenden Frau, nicht Flüchtling zu werden, sich nicht aufzugeben, sondern zurückzukehren in die zerstörte Stadt, die sein Zuhause ist.
So möchte man leben. Ist mir ein Vorbild.
... link (0 Kommentare) ... comment
Sonntag, 8. März 2009
„Am Rand“ von Şebnem Işigüzel - Interpretation der Seiten 52/53
damals, 22:14h
Wenn es Sonntag ist und regnet und kein Termin weit und breit, das sind die besten Tage. Die Kleinfamilie schlurte bis zwölf im Schlafanzug zwischen Bett (Morgenkaffee, Bilderbücher, Zeitung) und Sofa (Fernsehen: „Sendung mit der Maus“) hin und her, dann bewegte ich mich als Erster langsam in Richtung Badezimmer. Unterwegs am Nachttisch konnte ich nicht widerstehen und klappte für fünf – sechs Minuten meinen Roman auf, las zwei Seiten – und war schon wieder begeistert ...
Mein Roman ist noch ein Geburtstagsgeschenk, vom Dezember. Ich hatte mir ein Buch gewünscht, meine Frau hatte nicht gewusst welches und vorgeschlagen, sich von der Auslage bei Christiansen in Ottensen inspirieren zu lassen. Es lief auf eine Hitliste von drei Titeln hinaus: den ersten kriegte ich von meiner Frau (und der war schon super), Nr. 2 finanzierte ich mit dem Büchergutschein von der Firma – den lese ich gerade: „Am Rand“ von Şebnem Işigüzel. Die Autorin, hat man den Eindruck, arbeitet mit allen erlaubten und verbotenen Tricks, die einem Schriftsteller so zur Verfügung stehen. Man mag das unseriös finden. Aber ich liebe das, von jeder Seite so richtig durchgeschüttelt zu werden.
Inhaltlich geht es (bis jetzt jedenfalls) um eine türkische Schachspielerin, die Diplomatentochter Leyla, die durch eine unglückliche Kombination persönlich-familiärer wie politischer Gewalttätigkeiten so ins Straucheln gerät, dass sich die Obdachlosigkeit als die immer noch erträglichere Daseinsform erweist: „Dabei war sie so weit bei sich, dass sie denken konnte, sie sei verrückt oder wahnsinnig geworden. Wie wir alle hatte sie ihre Angelegenheiten mit Gott noch nicht abgeschlossen.“ So beginnt die S. 52, die ich vorhin las – und da kann man ja wohl nur zustimmen.
Und dann geht es weiter: Reminiszenzen ihrer internationalen Schachkollegen werden zitiert, anlässlich ihres Verschwindens geäußert. Es läuft darauf hinaus, dass sie „universal und harmonisch“ gespielt hat, mit einer intuitiven Logik – also gerade nicht mit einer auf den Gegner fixierten, den Gegner überlistenden Strategie, sondern mit einer hingebungsvollen Strategie, die den Plan aus der Eigenlogik der Figuren entwickelt. Da denkt man natürlich sofort an die „Schachnovelle“ von Zweig, an den Kitsch der klassischen Moderne, wo der fies rationale Czentovic über den intuitiv spielerischen freien Geist Dr. B. triumphiert.
Und wie um noch eins draufzusetzen, wird dann Nabokov zitiert: „Laylas Trainer Pinkoschow erinnerte sie an das, was Nabokov über Tolstois anna Karenina gesagt hatte: >Es ist so, dass wir manchmal das Gefühl haben, Tolstois Romane hätten sich von selbst geschrieben, als seien sie von ihrem Material, ihrem Sujet verfasst worden.< Diese Definition passte zu Leyla ...“ Nabokov also, dieses Lieblingskind der Modernisten, definiert, was universal und ewig ist.
In meinen Augen ist Nabokov aber eher ein Schriftsteller, der seine persönliche Heimatlosig- und Verlorenheit unter technischer Raffinesse versteckt. Und so sieht es wohl auch Işigüzel. Denn die Schachspielerin, die dermaßen frei, unindividuell und „universal“ spielt – die verschwindet auch ganz leicht von der Bildfläche: „Nun gab es auch keine Schachspielerin namens Leyla mehr.“
So ist es. Das Gehasche nach Größe, Universalität, Ewigkeit – es ist aussichtslos, wenn es nicht vom Ich ausgeht. Das dacht ich, als ich vorhin zufrieden und glücklich unter der Dusche stand. Ich dachte auch an meinen Kollegen H., der mich letzte Woche fragte, ob ich mit meinem zweiten Staatsexamen es nicht doch noch einmal an einer Schule probieren wolle. „Das ist nicht mein Milieu.“ hab ich geantwortet. Er lachte und sagte: „Na, dann bleibst du bei uns, bei den Eck- und Randgruppen.“ Gerne. „Am Rand“ ist mein Buch.
Übrigens: Es ist auch ein Buch ohne Verlagswerbung am Ende. In der heutigen Zeit ein Adelsausweis.
Mein Roman ist noch ein Geburtstagsgeschenk, vom Dezember. Ich hatte mir ein Buch gewünscht, meine Frau hatte nicht gewusst welches und vorgeschlagen, sich von der Auslage bei Christiansen in Ottensen inspirieren zu lassen. Es lief auf eine Hitliste von drei Titeln hinaus: den ersten kriegte ich von meiner Frau (und der war schon super), Nr. 2 finanzierte ich mit dem Büchergutschein von der Firma – den lese ich gerade: „Am Rand“ von Şebnem Işigüzel. Die Autorin, hat man den Eindruck, arbeitet mit allen erlaubten und verbotenen Tricks, die einem Schriftsteller so zur Verfügung stehen. Man mag das unseriös finden. Aber ich liebe das, von jeder Seite so richtig durchgeschüttelt zu werden.
Inhaltlich geht es (bis jetzt jedenfalls) um eine türkische Schachspielerin, die Diplomatentochter Leyla, die durch eine unglückliche Kombination persönlich-familiärer wie politischer Gewalttätigkeiten so ins Straucheln gerät, dass sich die Obdachlosigkeit als die immer noch erträglichere Daseinsform erweist: „Dabei war sie so weit bei sich, dass sie denken konnte, sie sei verrückt oder wahnsinnig geworden. Wie wir alle hatte sie ihre Angelegenheiten mit Gott noch nicht abgeschlossen.“ So beginnt die S. 52, die ich vorhin las – und da kann man ja wohl nur zustimmen.
Und dann geht es weiter: Reminiszenzen ihrer internationalen Schachkollegen werden zitiert, anlässlich ihres Verschwindens geäußert. Es läuft darauf hinaus, dass sie „universal und harmonisch“ gespielt hat, mit einer intuitiven Logik – also gerade nicht mit einer auf den Gegner fixierten, den Gegner überlistenden Strategie, sondern mit einer hingebungsvollen Strategie, die den Plan aus der Eigenlogik der Figuren entwickelt. Da denkt man natürlich sofort an die „Schachnovelle“ von Zweig, an den Kitsch der klassischen Moderne, wo der fies rationale Czentovic über den intuitiv spielerischen freien Geist Dr. B. triumphiert.
Und wie um noch eins draufzusetzen, wird dann Nabokov zitiert: „Laylas Trainer Pinkoschow erinnerte sie an das, was Nabokov über Tolstois anna Karenina gesagt hatte: >Es ist so, dass wir manchmal das Gefühl haben, Tolstois Romane hätten sich von selbst geschrieben, als seien sie von ihrem Material, ihrem Sujet verfasst worden.< Diese Definition passte zu Leyla ...“ Nabokov also, dieses Lieblingskind der Modernisten, definiert, was universal und ewig ist.
In meinen Augen ist Nabokov aber eher ein Schriftsteller, der seine persönliche Heimatlosig- und Verlorenheit unter technischer Raffinesse versteckt. Und so sieht es wohl auch Işigüzel. Denn die Schachspielerin, die dermaßen frei, unindividuell und „universal“ spielt – die verschwindet auch ganz leicht von der Bildfläche: „Nun gab es auch keine Schachspielerin namens Leyla mehr.“
So ist es. Das Gehasche nach Größe, Universalität, Ewigkeit – es ist aussichtslos, wenn es nicht vom Ich ausgeht. Das dacht ich, als ich vorhin zufrieden und glücklich unter der Dusche stand. Ich dachte auch an meinen Kollegen H., der mich letzte Woche fragte, ob ich mit meinem zweiten Staatsexamen es nicht doch noch einmal an einer Schule probieren wolle. „Das ist nicht mein Milieu.“ hab ich geantwortet. Er lachte und sagte: „Na, dann bleibst du bei uns, bei den Eck- und Randgruppen.“ Gerne. „Am Rand“ ist mein Buch.
Übrigens: Es ist auch ein Buch ohne Verlagswerbung am Ende. In der heutigen Zeit ein Adelsausweis.
... link (1 Kommentar) ... comment
Donnerstag, 15. Januar 2009
Meine scharfsinnige Analyse von Uwe Tellkamps "Der Turm", Teil 2
damals, 21:38h
Im zweiten Teil des Buches nimmt das Tempo zu, die Länge der Sätze ab. Menos Lieblingsautorin Judith Schevola wird vom Schriftstellerverband geschasst, Christian kommt zur Armee. Die anderen Figuren machen weiter wie bisher, was angesichts der Umstände immer alberner wird.
Denn die Armeegeschichte um Christian bringt auf den Punkt, wie schlimm alles ist. Kein Platz mehr für Lyrik. Die brutalen Quälereien im Zuge der berüchtigten EK-Bewegung veranlassen Christian stillzuhalten und sich später einer der brutalsten, aber auch souveränsten Figuren anzuschließen: dem Schwarzhändler Pfannkuchen. Endlich gelingt es Christian, in einer überbordenden Situation seine Wut herauszubrüllen. Die Folge ist Schwedt, der Militärknast. Sein Beschützer Pfannkuchen, der ihm beigesprungen ist, muss mit ihm gehen. Es ist ein grausiger Weg, der da beschrieben wird, und besonders grausig ist, dass es für Christian ein Weg in die Emanzipation ist.
Am Ende zerfällt die DDR und man kann nicht mal richtig froh sein. Höchstens erleichtert.
Und was fand ich an dem Buch nun so gut? Das, was der Literaturkritiker Denis Scheck so furchtbar daran fand: dass es „nach Schweiß“ stinkt. Tellkamps Buch ist das Gegenteil von Breloers diszipliniert kalkulierten Werken. Da hat sich einer sehr viel vorgenommen und ist in vielem davon gescheitert, in manchem nicht. Da spürt man in jeder Zeile, dass da ein Mensch um seine Sprache kämpft. Er probiert es mal mythisch-metaphorisch, mal sachlich berichtend, mal satirisch. Sowohl was den Handlungsfaden als auch was den Stil betrifft, setzt er immer wieder neu an, als hätte er den Eindruck, es wieder nicht auf den Punkt getroffen zu haben. Dadurch entsteht ein Buch, das schwer zu lesen, aber ungeheuer reich ist. Nichts ist so, wie es scheint. Die Bewertungen der Figuren werden wieder und wieder umgedreht. Immer, wenn man hundert Seiten gelesen hat, sieht dieselbe Welt wieder völlig anders aus.
Und wenn Ihr mich fragt: Auf den Punkt getroffen hat Tellkamp meistens da, wo er sich am wenigsten anstrengt - in der Beschreibung kleiner Alltagssituationen, die „in nuce“ das ganze Stimmungs- und Konfliktpotential der späten DDR offenbaren.
Vielfach hört man die Meinung, „Der Turm“ sei ein genüsslich zu lesendes Buch, das die Welt der Bildungsbürger nostalgisch heraufbeschwört. Oder gar ein Buch, das sich zur Aufgabe gemacht hätte, die nachträgliche Verklärung der politischen Verhältnisse in der DDR zu entlarven. Nichts ist falscher, nichts ist oberflächlicher als solche Meinungen. „Der Turm“ hat keine platten Botschaften, er ist auch nicht gut zu lesen, die Schätze in ihm, die muss man suchen. Er ist depressiv und schüchtern aufbegehrend, selbstgerecht und angepasst, ärgerlich platt und beeindruckend feinsinnig. Alles, was man will. Nehmt Euch die Zeit und sucht Euren Schatz aus diesem herrlichen Wildwuchs.
Denn die Armeegeschichte um Christian bringt auf den Punkt, wie schlimm alles ist. Kein Platz mehr für Lyrik. Die brutalen Quälereien im Zuge der berüchtigten EK-Bewegung veranlassen Christian stillzuhalten und sich später einer der brutalsten, aber auch souveränsten Figuren anzuschließen: dem Schwarzhändler Pfannkuchen. Endlich gelingt es Christian, in einer überbordenden Situation seine Wut herauszubrüllen. Die Folge ist Schwedt, der Militärknast. Sein Beschützer Pfannkuchen, der ihm beigesprungen ist, muss mit ihm gehen. Es ist ein grausiger Weg, der da beschrieben wird, und besonders grausig ist, dass es für Christian ein Weg in die Emanzipation ist.
Am Ende zerfällt die DDR und man kann nicht mal richtig froh sein. Höchstens erleichtert.
Und was fand ich an dem Buch nun so gut? Das, was der Literaturkritiker Denis Scheck so furchtbar daran fand: dass es „nach Schweiß“ stinkt. Tellkamps Buch ist das Gegenteil von Breloers diszipliniert kalkulierten Werken. Da hat sich einer sehr viel vorgenommen und ist in vielem davon gescheitert, in manchem nicht. Da spürt man in jeder Zeile, dass da ein Mensch um seine Sprache kämpft. Er probiert es mal mythisch-metaphorisch, mal sachlich berichtend, mal satirisch. Sowohl was den Handlungsfaden als auch was den Stil betrifft, setzt er immer wieder neu an, als hätte er den Eindruck, es wieder nicht auf den Punkt getroffen zu haben. Dadurch entsteht ein Buch, das schwer zu lesen, aber ungeheuer reich ist. Nichts ist so, wie es scheint. Die Bewertungen der Figuren werden wieder und wieder umgedreht. Immer, wenn man hundert Seiten gelesen hat, sieht dieselbe Welt wieder völlig anders aus.
Und wenn Ihr mich fragt: Auf den Punkt getroffen hat Tellkamp meistens da, wo er sich am wenigsten anstrengt - in der Beschreibung kleiner Alltagssituationen, die „in nuce“ das ganze Stimmungs- und Konfliktpotential der späten DDR offenbaren.
Vielfach hört man die Meinung, „Der Turm“ sei ein genüsslich zu lesendes Buch, das die Welt der Bildungsbürger nostalgisch heraufbeschwört. Oder gar ein Buch, das sich zur Aufgabe gemacht hätte, die nachträgliche Verklärung der politischen Verhältnisse in der DDR zu entlarven. Nichts ist falscher, nichts ist oberflächlicher als solche Meinungen. „Der Turm“ hat keine platten Botschaften, er ist auch nicht gut zu lesen, die Schätze in ihm, die muss man suchen. Er ist depressiv und schüchtern aufbegehrend, selbstgerecht und angepasst, ärgerlich platt und beeindruckend feinsinnig. Alles, was man will. Nehmt Euch die Zeit und sucht Euren Schatz aus diesem herrlichen Wildwuchs.
... link (3 Kommentare) ... comment
Mittwoch, 14. Januar 2009
Meine scharfsinnige Analyse von Uwe Tellkamps "Der Turm", Teil 1
damals, 23:50h
Empfehlen muss ich diesmal einen Bestseller. Denn er ist wirklich gut. Ich hätte das vorher auch nicht gedacht, schließlich hat Tellkamp mit einer Vorarbeit zu diesem Buch den Bachmannpreis gewonnen – und diese Vorarbeit war eher – naja, wie sagt man: aufgesetzt? künstlich? musterschülerhaft? – jedenfalls kein Lesespaß und unerträglich bildungshuberisch. Prompt hat es dieser kleine Text ("Der Schlaf in den Uhren") auch ins niedersächsische Zentralabitur geschafft. Ich fand das lustig, ich konnte mir richtig vorstellen, wie jetzt die Studienräte dasitzen und sich sagen: Ja, das ist noch richtig anspruchsvolle Literatur und die Kinder sollen ruhig mal ins Schwitzen kommen in der Klausur.
Wie dem auch sei, auch im „Turm“ sind die Stellen die schlechtesten, wo Tellkamp beweist, was er alles weiß. Dass alte metallene Uhrenzifferblätter „gepunzt“ wurden. Welche Witze man sich 1983 in DDR erzählt hat. Wer zwischen 1930 und 1950 so alles den „Rosenkavalier“ dirigiert hat. Usw. Gähn.
Alles ist auf ein „Opus magnum“ hin angelegt. Der Autor malt ein breites Panorama des Dresden der achtziger Jahre. Im Mittelpunkt steht eine Medizinerfamilie, die halbwüchsigen Robert und Christian Hoffmann, ihre Eltern Anne und Richard (Krankenschwester und Handchirurg) sowie diverse Onkel, Tanten, Nichten und Neffen. Im Mittelpunkt steht die Figur Christian und deren noch pubertäre Sichtweise, was dazu führt, dass Christians Charakter (zumindest im ersten Teil des Buches) ziemlich blass bleibt, z. B. im Vergleich zu den breit ausgemalten Szenen aus dem Klinikleben des Vaters.
Die zweite Hauptfigur ist Christians Lieblingsonkel Meno, Lektor, ein introvertierter, fast schrulliger Beobachter und Schweiger, dessen lyrische Ergüsse oft kursiv in den Text gesetzt sind, versponnene Endlosmonologe zwischen Ironie und gewagter Metaphorik. Meno kennt auch Arbogast, der unschwer als Manfred von Ardenne zu erkennen ist und als solcher in keinem Dresden-Buch fehlen darf.
Ansonsten besteht Menos Arbeit vor allem darin, sich zu den Texten der von ihm betreuten kritischen Autoren möglichst nicht zu äußern, während Christian, abgeschoben ins Internat, die volle Wucht sozialistischer Erziehung zu erleiden hat und heimlich in Verena verliebt ist, weil die sich traut, dem Staatsbürgekundelehrer zu widersprechen. In Christian wiederum verliebt ist Reina, eine scheinbar naive, doch menschlich offene und faire Anhängerin des Sozialismus. Christian, angesteckt von der neurotischen Angst der Elterngeneration, fragt sich (und später seinen Onkel Meno), ob man eine solche Person möglicherweise zurücklieben dürfe. Der sagt erschrocken „nein“. Währenddessen hat sein Vater eine Geliebte und wird damit von der Stasi erpresst.
Wie dem auch sei, auch im „Turm“ sind die Stellen die schlechtesten, wo Tellkamp beweist, was er alles weiß. Dass alte metallene Uhrenzifferblätter „gepunzt“ wurden. Welche Witze man sich 1983 in DDR erzählt hat. Wer zwischen 1930 und 1950 so alles den „Rosenkavalier“ dirigiert hat. Usw. Gähn.
Alles ist auf ein „Opus magnum“ hin angelegt. Der Autor malt ein breites Panorama des Dresden der achtziger Jahre. Im Mittelpunkt steht eine Medizinerfamilie, die halbwüchsigen Robert und Christian Hoffmann, ihre Eltern Anne und Richard (Krankenschwester und Handchirurg) sowie diverse Onkel, Tanten, Nichten und Neffen. Im Mittelpunkt steht die Figur Christian und deren noch pubertäre Sichtweise, was dazu führt, dass Christians Charakter (zumindest im ersten Teil des Buches) ziemlich blass bleibt, z. B. im Vergleich zu den breit ausgemalten Szenen aus dem Klinikleben des Vaters.
Die zweite Hauptfigur ist Christians Lieblingsonkel Meno, Lektor, ein introvertierter, fast schrulliger Beobachter und Schweiger, dessen lyrische Ergüsse oft kursiv in den Text gesetzt sind, versponnene Endlosmonologe zwischen Ironie und gewagter Metaphorik. Meno kennt auch Arbogast, der unschwer als Manfred von Ardenne zu erkennen ist und als solcher in keinem Dresden-Buch fehlen darf.
Ansonsten besteht Menos Arbeit vor allem darin, sich zu den Texten der von ihm betreuten kritischen Autoren möglichst nicht zu äußern, während Christian, abgeschoben ins Internat, die volle Wucht sozialistischer Erziehung zu erleiden hat und heimlich in Verena verliebt ist, weil die sich traut, dem Staatsbürgekundelehrer zu widersprechen. In Christian wiederum verliebt ist Reina, eine scheinbar naive, doch menschlich offene und faire Anhängerin des Sozialismus. Christian, angesteckt von der neurotischen Angst der Elterngeneration, fragt sich (und später seinen Onkel Meno), ob man eine solche Person möglicherweise zurücklieben dürfe. Der sagt erschrocken „nein“. Währenddessen hat sein Vater eine Geliebte und wird damit von der Stasi erpresst.
... link (0 Kommentare) ... comment
Samstag, 3. Januar 2009
Das Jahrhundertbuch (Januar 04)
damals, 18:49h
Folgender Text entstand in den letzten Tagen im Zug:
„Mein Jahrhundertbuch. 51 Liebeserklärungen.“ Wie kam dieses Buch auf den Hocker neben meinem Bett, in diesen Stapel von Schriften, die ich lesen wollte, aber nicht werde? Ich weiß nicht mehr, wer es mir mitgebracht hat – selbst würd ich mir so was ja nie kaufen – ein „ZEIT-Buch“ (!), „herausgegeben von Iris Radisch" (!), Studienratslektüre für Leute, die Literatur nicht selber lesen, sondern nur darüber informiert sein wollen. Bei mir im Zimmer kann man sich aus erster Hand informieren, was das wichtigste Buch des 20. Jahrhunderts sein soll – oder könnte es jedenfalls. Die Staubschichten auf den Bücherreihen zeigen, dass keiner diese Möglichkeit nutzt, ich nicht und ein anderer schon gar nicht. Hat mir deshalb einer dieses Buch geschenkt? Einer von denen, die sich damals über Iris Radisch und Sigrid Löffler im „Literarischen Quartett“ die Köpfe heiß redeten und sich wunderbar literarisch interessiert dabei vorkamen, obwohl sie ihre Freizeit mit jeweils 2-3 verzogenen Gören sowie in Sportklubs und vor CD- und DVD-Regalen verbringen, anstatt zu lesen, und die in mir, in ihrer Freundschaft zu mir immerhin den Beweis sehen, dass sie noch nicht ganz verblödet sind?
Und jetzt kräht selbst ein Säugling im Zimmer neben meinem, einer, der nichts weiß von Iris Radisch und der ZEIT, einer, der mich anlachen möchte oder schreien oder einfach umhersabbern und an seinen Zehen spielen – alles, nur nicht schlafen, und noch schlimmer, jetzt geh ich jeden Tag arbeiten, um Geld heranzuschaffen für die Frau, die ihn stillt und die mich zu umarmen versucht, wenn ich schon nichts mehr spüre, weil es so warm ist, so überheizt in dieser überfüllten Zwei-Zimmer-Wohnung und ich den Tag, den lieben langen Tag in Klassenzimmern verbracht habe und vergeblich den Lehrer gespielt, eine Figur also, die ich selber bedauert habe, als ich noch Schüler war und frei zu denken, was ich wollte.
Aber das wollte ich nicht sagen, ich wollte über „Das Jahrhundertbuch“ reden. Wollte mich lustig machen, wie erwartungsgemäß langweilig da alles daherkommt: wenn Jerofejew sich aus fadenscheinigen Gründen für Nabokows „Lolita“ begeistert – weil ihn der Verkaufserfolg offenbar mehr fasziniert als die guten Bücher, die Nabokow immerhin auch geschrieben hat. Wenn Salman Rushdie ganz den gelehrigen 3.-Weltler markiert, indem er den mainstreamigsten Klassiker aus der 1.-Welt-Literatur empfiehlt: „Ulysses“, den keiner von uns gelesen hat, es sei denn im Grundstudium oder an der Volkshochschule. Und wenn den mittleren Europäern nichts anderes einfällt als Kafka, Kafka und natürlich Hitler und Stalin.
Jetzt liegt dieses langweilige Buch auf meinem Nachttisch, auf dem Gerät, das mein Nachttisch sein soll oder hätte sein sollen. Denn wozu brauche ich einen Nachttisch, da ich abends nicht zum Lesen komme und morgens aus dem Bett spring, weil ichs eilig hab. Und die Brille leg ich lieber auf das Fensterbrett. Die Sachen auf den Fußboden, weil mich das an das Chaos von früher erinnert, als es noch ein fröhliches war. Meine Freundin liegt nebenan mit dem Kleinen und auch ich liege manchmal nebenan, meistens sogar um ehrlich zu sein, wenn mir nach Nähe ist, wenn ich lebendig bin. Und das Buch auf meinem Nachttisch verstaubt. Was sollte ich auch damit in einer Welt, in der es keine patriarchalischen Diktatoren gibt und auch keine Lolitas.
Mein Chef ist ein müder, alter Mann, weißhaarig, mit traurigen Augen und einer Vorliebe für kleine Witze und ironische Bemerkungen. Entscheidungen scheut er. Dass er mir gekündigt hat letzte Woche, das war überhaupt nicht er, das ist wie ein Blitzschlag durch ihn durchgegangen von irgendwoher – das hat nun mich getroffen, und er blickt sich verwundert um, wie er das Phänomen überlebt hat. Wie ich es überlebt habe, interessiert ihn so wenig wie die meisten Erscheinungen dieser Welt.
Und ich wittere eine Chance, wieder zu meinen Büchern zu kommen, in meine Bücherhöhle, in die Phantasiewelt des 20. Jahrhunderts: wo es um Macht geht und Katastrophen, um zerstörerische Triebe und Giganten, die ganze Völker morden, um die Größe des Untergangs. Ja, ich weiß, es gibt das alles. Aber es ist nur ein Bruchteil, es sind nur Buchtitel, es ist nicht das Ganze. Und ich, wenn ich das Buch des Jahrhunderts wählen sollte, ich nennte nicht den „Prozess“ und auch nicht „Das kleine Arschloch“ – sondern den „Roman eines Schicksallosen“. Oder Anna Seghers’ Roman über den Identitätslosen, der bleiben will, bleiben und leben.
„Mein Jahrhundertbuch. 51 Liebeserklärungen.“ Wie kam dieses Buch auf den Hocker neben meinem Bett, in diesen Stapel von Schriften, die ich lesen wollte, aber nicht werde? Ich weiß nicht mehr, wer es mir mitgebracht hat – selbst würd ich mir so was ja nie kaufen – ein „ZEIT-Buch“ (!), „herausgegeben von Iris Radisch" (!), Studienratslektüre für Leute, die Literatur nicht selber lesen, sondern nur darüber informiert sein wollen. Bei mir im Zimmer kann man sich aus erster Hand informieren, was das wichtigste Buch des 20. Jahrhunderts sein soll – oder könnte es jedenfalls. Die Staubschichten auf den Bücherreihen zeigen, dass keiner diese Möglichkeit nutzt, ich nicht und ein anderer schon gar nicht. Hat mir deshalb einer dieses Buch geschenkt? Einer von denen, die sich damals über Iris Radisch und Sigrid Löffler im „Literarischen Quartett“ die Köpfe heiß redeten und sich wunderbar literarisch interessiert dabei vorkamen, obwohl sie ihre Freizeit mit jeweils 2-3 verzogenen Gören sowie in Sportklubs und vor CD- und DVD-Regalen verbringen, anstatt zu lesen, und die in mir, in ihrer Freundschaft zu mir immerhin den Beweis sehen, dass sie noch nicht ganz verblödet sind?
Und jetzt kräht selbst ein Säugling im Zimmer neben meinem, einer, der nichts weiß von Iris Radisch und der ZEIT, einer, der mich anlachen möchte oder schreien oder einfach umhersabbern und an seinen Zehen spielen – alles, nur nicht schlafen, und noch schlimmer, jetzt geh ich jeden Tag arbeiten, um Geld heranzuschaffen für die Frau, die ihn stillt und die mich zu umarmen versucht, wenn ich schon nichts mehr spüre, weil es so warm ist, so überheizt in dieser überfüllten Zwei-Zimmer-Wohnung und ich den Tag, den lieben langen Tag in Klassenzimmern verbracht habe und vergeblich den Lehrer gespielt, eine Figur also, die ich selber bedauert habe, als ich noch Schüler war und frei zu denken, was ich wollte.
Aber das wollte ich nicht sagen, ich wollte über „Das Jahrhundertbuch“ reden. Wollte mich lustig machen, wie erwartungsgemäß langweilig da alles daherkommt: wenn Jerofejew sich aus fadenscheinigen Gründen für Nabokows „Lolita“ begeistert – weil ihn der Verkaufserfolg offenbar mehr fasziniert als die guten Bücher, die Nabokow immerhin auch geschrieben hat. Wenn Salman Rushdie ganz den gelehrigen 3.-Weltler markiert, indem er den mainstreamigsten Klassiker aus der 1.-Welt-Literatur empfiehlt: „Ulysses“, den keiner von uns gelesen hat, es sei denn im Grundstudium oder an der Volkshochschule. Und wenn den mittleren Europäern nichts anderes einfällt als Kafka, Kafka und natürlich Hitler und Stalin.
Jetzt liegt dieses langweilige Buch auf meinem Nachttisch, auf dem Gerät, das mein Nachttisch sein soll oder hätte sein sollen. Denn wozu brauche ich einen Nachttisch, da ich abends nicht zum Lesen komme und morgens aus dem Bett spring, weil ichs eilig hab. Und die Brille leg ich lieber auf das Fensterbrett. Die Sachen auf den Fußboden, weil mich das an das Chaos von früher erinnert, als es noch ein fröhliches war. Meine Freundin liegt nebenan mit dem Kleinen und auch ich liege manchmal nebenan, meistens sogar um ehrlich zu sein, wenn mir nach Nähe ist, wenn ich lebendig bin. Und das Buch auf meinem Nachttisch verstaubt. Was sollte ich auch damit in einer Welt, in der es keine patriarchalischen Diktatoren gibt und auch keine Lolitas.
Mein Chef ist ein müder, alter Mann, weißhaarig, mit traurigen Augen und einer Vorliebe für kleine Witze und ironische Bemerkungen. Entscheidungen scheut er. Dass er mir gekündigt hat letzte Woche, das war überhaupt nicht er, das ist wie ein Blitzschlag durch ihn durchgegangen von irgendwoher – das hat nun mich getroffen, und er blickt sich verwundert um, wie er das Phänomen überlebt hat. Wie ich es überlebt habe, interessiert ihn so wenig wie die meisten Erscheinungen dieser Welt.
Und ich wittere eine Chance, wieder zu meinen Büchern zu kommen, in meine Bücherhöhle, in die Phantasiewelt des 20. Jahrhunderts: wo es um Macht geht und Katastrophen, um zerstörerische Triebe und Giganten, die ganze Völker morden, um die Größe des Untergangs. Ja, ich weiß, es gibt das alles. Aber es ist nur ein Bruchteil, es sind nur Buchtitel, es ist nicht das Ganze. Und ich, wenn ich das Buch des Jahrhunderts wählen sollte, ich nennte nicht den „Prozess“ und auch nicht „Das kleine Arschloch“ – sondern den „Roman eines Schicksallosen“. Oder Anna Seghers’ Roman über den Identitätslosen, der bleiben will, bleiben und leben.
... link (0 Kommentare) ... comment
Freitag, 25. Juli 2008
Shani Katayun: Augen in Teheran
damals, 00:35h
Was wirklich schön ist an meiner Arbeit (Deutsch-Unterricht für Ausländer), ist, dass man so viel von der Welt erfährt, ohne seinen engsten Umkreis verlassen zu müssen: Vor ein paar Wochen sagte mir eine iranische Kollegin zwischen Tür und Angel: "ich habe einen Roman geschrieben." Ich war ganz baff, und schon aus Kollegen-Solidarität kaufte ich ihn. Dann las ich ihn - und er war eine echte Entdeckung. Hier meine Rezension -für alle, die jenseits des professionellen Mainstreams spannendes Lesefutter suchen:
Dieser Roman hat eher die Qualitäten eines Berichts: in künstlerischer Hinsicht bescheiden, dafür aber gut und flüssig geschrieben – und faszinierend durch seine Lebensechtheit. Wer mehr über den Iran wissen will, als aus den Politikteilen unserer Tageszeitungen ersichtlich ist, sollte zu diesem Buch greifen. Man erlebt eine Diktatur, in der politische Unfreiheit Hand in Hand mit westlichem Lebensstil und stockkonservativen Familientradition geht. (Eine „Emanzipation der Miniröcke“ nennt das die Autorin: Miniröcke sind üblich, Zwangsverheiratungen auch.) Außerdem gibt es eine echte Befreiungsbewegung (die islamistische), die autoritär und reaktionär ist; einen Freiheitshelden (kommunistisch), der seine Freundin benutzt und bevormundet; einen deutschen Journalisten (liberal und weltoffen), der insgeheim nur das Geld liebt ... und zwischen all dem drei Schwestern, die immer wieder betrogen werden: im Namen der islamischen Tradition, im Namen des Kommunismus, im Namen der westlichen Freiheit – kurz: im Namen der Männer. Traurig.
Dieser Roman hat eher die Qualitäten eines Berichts: in künstlerischer Hinsicht bescheiden, dafür aber gut und flüssig geschrieben – und faszinierend durch seine Lebensechtheit. Wer mehr über den Iran wissen will, als aus den Politikteilen unserer Tageszeitungen ersichtlich ist, sollte zu diesem Buch greifen. Man erlebt eine Diktatur, in der politische Unfreiheit Hand in Hand mit westlichem Lebensstil und stockkonservativen Familientradition geht. (Eine „Emanzipation der Miniröcke“ nennt das die Autorin: Miniröcke sind üblich, Zwangsverheiratungen auch.) Außerdem gibt es eine echte Befreiungsbewegung (die islamistische), die autoritär und reaktionär ist; einen Freiheitshelden (kommunistisch), der seine Freundin benutzt und bevormundet; einen deutschen Journalisten (liberal und weltoffen), der insgeheim nur das Geld liebt ... und zwischen all dem drei Schwestern, die immer wieder betrogen werden: im Namen der islamischen Tradition, im Namen des Kommunismus, im Namen der westlichen Freiheit – kurz: im Namen der Männer. Traurig.
... link (0 Kommentare) ... comment
Freitag, 18. Juli 2008
Achtung, Wiederholung: "Das Leben der Anderen"
damals, 15:34h
Aus gegebenem Anlass (Lady Woodstock hat nachgefragt) äußere ich mich nochmal zum "Leben der Anderen" (hier mein erster Text dazu: http://damals.blogger.de/stories/751508/.)
Als der Film rauskam und dank massiven Werbeeinsatzes und prominenter Besetzung gleich überall im Gespräch war, wurde Donnersmarck in einer Talk Show von dem Schauspieler Henry Hübchen massiv angegriffen. In diesem Zusammenhang schrieb ich einen Kommentar in dem Blog von Herrn Donnersmarck, aus dem ich hier zitiere:
Viele Menschen, auch aus meinem Bekanntenkreis, haben „Das Leben der anderen“ mit Rührung und Begeisterung gesehen – während mich der Film genervt hat, aggressiv gemacht hat.
Zwar ist Ihre Analyse der späten DDR meines Erachtens rein sachlich völlig richtig. Insofern kann ich mich als geborener DDR-Bürger in die Reihe der von Ihnen aufgerufenen Zeitzeugen einordnen. Dass Ihnen hier und da kleine historischen Fehler unterlaufen sind, wie das Feuilleton an diversen Stellen anmerkte, finde ich gar nicht so schlimm. Gut fand ich, wie genau in Ihrem Film die miefig-spießige Atmosphäre in der DDR der 80er Jahre getroffen und reproduziert wird. Nur: Wieso diese klischeehafte und eindimensionale Charakterzeichnung aller Figuren mit Ausnahme der Hauptfigur? „Da hätte ich mir auch nen >Tatort< ansehen können.“ meinte ein (westdeutscher) Bekannter nach dem Kinobesuch achselzuckend.
Und er hatte Recht: der aufrechte Intellektuelle in der unvermeidlichen Lederjacke, die geniale, aber verführbare Künstlerin (die als femme fatale natürlich am Ende unter die Räder kommen muss), der gefräßige und brutale Minister, ... das war schon schwer erträglich.
Natürlich ist solche Vereinfachung künstlerisch erlaubt, z. B. eben im „Tatort“: um eine im Kern richtige Gesellschaftsanalyse für den Sonntagabend tauglich zu machen, auf dass sie jedermann nach dem Abendbrot noch leichthin konsumieren kann. Oder weil es dem Regisseur gar nicht auf die Figuren ankommt, sondern auf irgendetwas anderes. Ich fragte mich, was Ihnen so wichtig war, dass Sie dafür einen Großteil des filmischen Geschehens zur „rührseligen Politschmonzette“ vereinfacht haben, wie Henry Hübchen richtig anmerkte.
Ging es Ihnen um das Ins-Bild-Setzen einer masochistischen Ohnmachtsfantasie? Um Mitgefühl für einen Spitzel, der menschliche Gefühle entwickelt (was normal und verständlich ist), sie aber nicht haben darf, der auch mal Schicksal spielen will wie seine mächtigen Chefs und dann die Folgen zu spüren bekommt – und nicht, nicht mal im Ansatz, begreift, dass das ganze Spiel mies ist, egal für wen man Partei ergreift? Er ist übrigens großartig geschildert, wie er mit seinem Wägelchen geduckt durch die Straßen läuft und Werbezeitungen verteilt und sich vermutlich ziemlich selbst bemitleidet. Genau so laufen sie noch heute rum in den neuen Bundesländern, diese miesen kleinen Würstchen, die uns regiert haben! Und glauben, sie wären die eigentlichen Opfer.
Oder wollten Sie einfach einen hollywoodtauglichen Film mit möglichst deutschem Sujet herstellen? Wofür ja die unangenehm kommerzielle und sicher sehr teure Werbekampagne für den Film spricht. (Wer hat die eigentlich bezahlt?)
Da muss man doch mit Hübchen daran erinnern, dass die Welt nicht so eindimensional ist, wie diese Stasi-Typen (und auch dieser Film) sie sehen. Wir waren Menschen und wir konnten (natürlich zu selten, natürlich nur manchmal) lachen über das Lächerliche und verachten, was verachtenswert ist. Die Machtbesessenheit dieses Systems und seiner Erfüllungsgehilfen, natürlich gab es die, aber ist sie das wirklich Erinnernswerte an der DDR?
Ich finde, bei der Übersetzung von DDR in Hollywood ist ein entscheidender Fehler unterlaufen: Die Logik, mit der in der DDR Angst erzeugt wurde, wurde exakt nachgebaut und überliefert – die Angst (und auch der Mut) derer, die diese Logik zu erdulden hatten, ist unter lauter Kitsch verschwunden.
Es mag sein, dass ich jetzt zu viel hineingesehen habe in Ihren Film, der ja nur ein Unterhaltungsfilm sein will. Aber immerhin, es ist ein Kinofilm, ein gefeierter, und der Bundestag ist auch schon da gewesen. Ach, hätten Sie doch lieber mit Fernsehen angefangen! (Irgendein Feuilleton berichtete, Sie hätten der Versuchung Fernsehregie widerstanden, um auf die Chance zum großen Kinofilm zu warten.) Hätten Sie das Ganze tatsächlich als „Tatort“ realisiert – es wäre sicher einer der besseren geworden. Und Sie hätten danach den Kopf und das Herz frei gehabt, um einen wirklichen, ein großen Kinofilm zu drehen.
Na ja, um mal zu zeigen, wie dieses Sujet "in echt" statt in Oscar-Manier geschildert werden kann, zitiere ich den zu Unrecht vergessenen Bernd Jentzsch:
Stoßgebet
Wenn einer wegwill und noch kein Greis ist, weder Dienstreisender noch Sportler, kein Kundschafter der heiligen Sache, dem stehe bei der Allmächtige der Vogelfreien, der achte auf seine geächtete Hand, die das unterschrieb, ich will hier raus, der hat sein Urteil gefällt, der darf nicht mehr sein in Lohn und Brot, ein Querulant unter Tausenden zu Abertausenden, in die Korrektionsanstalt mit dem, nach Waldheim, Bautzen, Hoheneck, nach Cottbus in die Dunkelzelle, singen lernen, verpfeifen, verraten und verkauft, der Verkauf der Landeskinder nach Hessen, Kopf um Kopf, der ist verlassen von allen guten Geistern und
stolpert vor die Kameras, die ersten Schüsse im Jenseits Schnappschüsse, Allmächtiger, mit aller Macht, dem stehe bei.
1978
Als der Film rauskam und dank massiven Werbeeinsatzes und prominenter Besetzung gleich überall im Gespräch war, wurde Donnersmarck in einer Talk Show von dem Schauspieler Henry Hübchen massiv angegriffen. In diesem Zusammenhang schrieb ich einen Kommentar in dem Blog von Herrn Donnersmarck, aus dem ich hier zitiere:
Viele Menschen, auch aus meinem Bekanntenkreis, haben „Das Leben der anderen“ mit Rührung und Begeisterung gesehen – während mich der Film genervt hat, aggressiv gemacht hat.
Zwar ist Ihre Analyse der späten DDR meines Erachtens rein sachlich völlig richtig. Insofern kann ich mich als geborener DDR-Bürger in die Reihe der von Ihnen aufgerufenen Zeitzeugen einordnen. Dass Ihnen hier und da kleine historischen Fehler unterlaufen sind, wie das Feuilleton an diversen Stellen anmerkte, finde ich gar nicht so schlimm. Gut fand ich, wie genau in Ihrem Film die miefig-spießige Atmosphäre in der DDR der 80er Jahre getroffen und reproduziert wird. Nur: Wieso diese klischeehafte und eindimensionale Charakterzeichnung aller Figuren mit Ausnahme der Hauptfigur? „Da hätte ich mir auch nen >Tatort< ansehen können.“ meinte ein (westdeutscher) Bekannter nach dem Kinobesuch achselzuckend.
Und er hatte Recht: der aufrechte Intellektuelle in der unvermeidlichen Lederjacke, die geniale, aber verführbare Künstlerin (die als femme fatale natürlich am Ende unter die Räder kommen muss), der gefräßige und brutale Minister, ... das war schon schwer erträglich.
Natürlich ist solche Vereinfachung künstlerisch erlaubt, z. B. eben im „Tatort“: um eine im Kern richtige Gesellschaftsanalyse für den Sonntagabend tauglich zu machen, auf dass sie jedermann nach dem Abendbrot noch leichthin konsumieren kann. Oder weil es dem Regisseur gar nicht auf die Figuren ankommt, sondern auf irgendetwas anderes. Ich fragte mich, was Ihnen so wichtig war, dass Sie dafür einen Großteil des filmischen Geschehens zur „rührseligen Politschmonzette“ vereinfacht haben, wie Henry Hübchen richtig anmerkte.
Ging es Ihnen um das Ins-Bild-Setzen einer masochistischen Ohnmachtsfantasie? Um Mitgefühl für einen Spitzel, der menschliche Gefühle entwickelt (was normal und verständlich ist), sie aber nicht haben darf, der auch mal Schicksal spielen will wie seine mächtigen Chefs und dann die Folgen zu spüren bekommt – und nicht, nicht mal im Ansatz, begreift, dass das ganze Spiel mies ist, egal für wen man Partei ergreift? Er ist übrigens großartig geschildert, wie er mit seinem Wägelchen geduckt durch die Straßen läuft und Werbezeitungen verteilt und sich vermutlich ziemlich selbst bemitleidet. Genau so laufen sie noch heute rum in den neuen Bundesländern, diese miesen kleinen Würstchen, die uns regiert haben! Und glauben, sie wären die eigentlichen Opfer.
Oder wollten Sie einfach einen hollywoodtauglichen Film mit möglichst deutschem Sujet herstellen? Wofür ja die unangenehm kommerzielle und sicher sehr teure Werbekampagne für den Film spricht. (Wer hat die eigentlich bezahlt?)
Da muss man doch mit Hübchen daran erinnern, dass die Welt nicht so eindimensional ist, wie diese Stasi-Typen (und auch dieser Film) sie sehen. Wir waren Menschen und wir konnten (natürlich zu selten, natürlich nur manchmal) lachen über das Lächerliche und verachten, was verachtenswert ist. Die Machtbesessenheit dieses Systems und seiner Erfüllungsgehilfen, natürlich gab es die, aber ist sie das wirklich Erinnernswerte an der DDR?
Ich finde, bei der Übersetzung von DDR in Hollywood ist ein entscheidender Fehler unterlaufen: Die Logik, mit der in der DDR Angst erzeugt wurde, wurde exakt nachgebaut und überliefert – die Angst (und auch der Mut) derer, die diese Logik zu erdulden hatten, ist unter lauter Kitsch verschwunden.
Es mag sein, dass ich jetzt zu viel hineingesehen habe in Ihren Film, der ja nur ein Unterhaltungsfilm sein will. Aber immerhin, es ist ein Kinofilm, ein gefeierter, und der Bundestag ist auch schon da gewesen. Ach, hätten Sie doch lieber mit Fernsehen angefangen! (Irgendein Feuilleton berichtete, Sie hätten der Versuchung Fernsehregie widerstanden, um auf die Chance zum großen Kinofilm zu warten.) Hätten Sie das Ganze tatsächlich als „Tatort“ realisiert – es wäre sicher einer der besseren geworden. Und Sie hätten danach den Kopf und das Herz frei gehabt, um einen wirklichen, ein großen Kinofilm zu drehen.
Na ja, um mal zu zeigen, wie dieses Sujet "in echt" statt in Oscar-Manier geschildert werden kann, zitiere ich den zu Unrecht vergessenen Bernd Jentzsch:
Stoßgebet
Wenn einer wegwill und noch kein Greis ist, weder Dienstreisender noch Sportler, kein Kundschafter der heiligen Sache, dem stehe bei der Allmächtige der Vogelfreien, der achte auf seine geächtete Hand, die das unterschrieb, ich will hier raus, der hat sein Urteil gefällt, der darf nicht mehr sein in Lohn und Brot, ein Querulant unter Tausenden zu Abertausenden, in die Korrektionsanstalt mit dem, nach Waldheim, Bautzen, Hoheneck, nach Cottbus in die Dunkelzelle, singen lernen, verpfeifen, verraten und verkauft, der Verkauf der Landeskinder nach Hessen, Kopf um Kopf, der ist verlassen von allen guten Geistern und
stolpert vor die Kameras, die ersten Schüsse im Jenseits Schnappschüsse, Allmächtiger, mit aller Macht, dem stehe bei.
1978
... link (5 Kommentare) ... comment
Montag, 24. März 2008
Orhan Pamuks "Istanbul" - So müsste man schreiben können!
damals, 23:20h
Meine Bekanntschaft mit Orhan Pamuk verdanke ich dem Feuilleton. Das war entzückt von seinem Roman „Schnee“, für den er den Friedenspreis des deutschen Buchhandels bekam. Pamuk passte hervorragend ins Bild: Wer sonst könnte einem die rückständige Türkei erklären als ein liberaler Intellektueller, der tatsächlich von da stammt, jedoch schon als Jugendlicher im heimischen Istanbul eine amerikanische Schule besuchte und später in New York lebte?
Auch mich lockte „Schnee“, versprach der Roman laut der Rezensionen doch orientalische Exotik ebenso wie literarische Bezüge auf Kafka und Tonio Kröger, die meine engste literarische Heimat darstellen. Ich wagte es, das Buch neu, teuer und gebunden zu kaufen – und sollte nicht enttäuscht werden. Das wurde schon auf den ersten zwanzig Seiten klar. Da begibt sich die Hauptfigur auf eine umständliche, langatmig beschriebene Busreise in die winterliche Osttürkei, und es passiert nichts, außer dass man verzaubert wird. Das passiert langsam, unspektakulär, ganz ohne fantasymäßigen Thrill – das Abenteuer heißt ja auch Gegenwart ...
Aber ich will nicht abschweifen. Ich habe „Schnee“ (wirklich der beste Roman, den ich in den letzten zehn Jahren gelesen habe) nur erwähnt, um verständlich zu machen, wie ich auf „Istanbul“, sein nächstes Buch, wartete. Eigentlich konnte ich mir nicht vorstellen, dass ein essayistisches Buch über die eigene Heimatstadt, also ein Text aus einem eher niedrigen, allenfalls journalistischen Genre, ähnlich großartig sein sollte wie ein richtiger Roman.
Understatement ist allerdings gerade der Trick des Buches. Pamuk beginnt, indem er ganz banal über seine Kindheit erzählt, über vorpubertäre Allmachtsphantasien eines weichen Kindes aus gutem Hause – und das Ganze auch noch mit Schnappschüssen aus dem Familienalbum illustriert. Im Folgenden wechseln Familienanekdötchen mit essayistischen Berichten über Istanbulansichten des 19. Jahrhunderts oder Lokalgrößen des Istanbuler Kulturlebens von anno dazumal. Einmal versteigt er sich sogar zu einer Beschreibung der speziell Istanbuler Melancholie in Form einer seitenlangen Aufzählung trauriger Dinge.
Erst nach 200 Seiten, der Hälfte des Buches, wenn alle politikfixierten Leser unweigerlich vergrault sind, lässt er die Katze aus dem Sack: Natürlich war das nicht naiv, sondern sehr bewusst politisch, dass er die finanziellen Verhältnisse seiner Familie, ihre konkreten Lebensgewohnheiten und Ansichten offen darlegt. Und es war auch kein sentimentales Sich-Verlieren, wenn er die malerischen Brände von alten Holzpalästen breit ausmalte, die er als Kind erlebt hat, oder die Autofahrten der Familie an den Bosporus. Er erzählt exemplarisch von sich: „So funktioniert das Leben bei uns.“ – um aufzuklären, nicht um irgendjemanden zu denunzieren (wie Aufklärung heute ja oft missverstanden wird). Die spielerischen Ausflüge in die Kulturgeschichte nutzt er dabei elegant, um historisch wie sozial über das Fallbeispiel seiner Familie hinauszuweisen.
In der zweiten Hälfte des Buches wird diese aufklärerische Absicht wie gesagt offensichtlich, so sehr sogar, dass sie auch in die Kapitelüberschriften Eingang findet: „Eroberung oder Fall? Die Türkisierung Konstantinopels“ oder gleich darauf „Religion“. Immer aber verankert er allgemeinere Aussagen im eigenen Erleben. Zum Beispiel erwähnt er unter „Türkisierung“ zwar die Zwänge des NATO-Mitglieds Türkei und ihrer Regierung in den fünfziger Jahren angesichts der Zypernkrise, ihr Schwanken zwischen Kuschen vor dem Westen und heimlicher Aufhetzung der eigenen Bevölkerung. Aber das ist nicht das Thema, das ist nur notwendige Hintergrundinformation. Das Thema ist, was dann tatsächlich in Istanbul los war und was er erlebt hat: die antigriechischen Pogrome. Oder er schildert seine pubertätstypischen Verrenkungen in Bezug auf die Religion (Wie streng soll man den Ramadan einhalten?), und plötzlich spürt man, das ist ja gar nicht allein sein Problem, das ist ja die Widersprüchlichkeit der ganzen Gesellschaft in religiösen Dingen.
Und überhaupt: „Fremd in einer ausländischen Schule“ heißt eine der schönsten Kapitelüberschriften. Aber wer ist hier gemeint? Orhan Pamuk oder Istanbul? Oder die ganze Türkei? Für diese mehrdeutigen Überschriften liebe ich dieses Buch. Denn sie zeigen den Sinn, den es überhaupt hat, über Politik nachzudenken: Ich lebe in der Welt, und deshalb möchte ich wissen, wie sie ist. Und was ich herausgefunden habe, das will ich auch sagen.
In Vorbereitung dieses Textes las ich in der Wikipedia, und da stand, dass manche Leser Pamuks kritische Ausführungen über die Türkei zum Anlass nahmen zu sagen: Na also, und so ein Land will nun in die EU. Was für ein Denkfehler! Dass wir keine solchen Bücher wie „Schnee“ oder „Istanbul“ haben, das liegt doch nicht daran, dass es in unserm Land nichts zu kritisieren gäbe – es liegt daran, dass wir keinen Orhan Pamuk haben!
Mir jedenfalls ist der Mann ein Vorbild: Er lässt sich nicht davon beirren, dass seine Aussagen (von seinen Befürwortern wie von seinen Gegnern) natürlich politisch missbraucht werden. Und lässt sich davon auch nicht hinreißen, sich in irgendwelche politischen Kämpfe einzuordnen. Sondern bleibt bei sich. Die letzte Kapitelüberschrift in „Istanbul“ lautet: „Ein Gespräch mit meiner Mutter: Geduld, Vorsicht, Kunst“.
Auch mich lockte „Schnee“, versprach der Roman laut der Rezensionen doch orientalische Exotik ebenso wie literarische Bezüge auf Kafka und Tonio Kröger, die meine engste literarische Heimat darstellen. Ich wagte es, das Buch neu, teuer und gebunden zu kaufen – und sollte nicht enttäuscht werden. Das wurde schon auf den ersten zwanzig Seiten klar. Da begibt sich die Hauptfigur auf eine umständliche, langatmig beschriebene Busreise in die winterliche Osttürkei, und es passiert nichts, außer dass man verzaubert wird. Das passiert langsam, unspektakulär, ganz ohne fantasymäßigen Thrill – das Abenteuer heißt ja auch Gegenwart ...
Aber ich will nicht abschweifen. Ich habe „Schnee“ (wirklich der beste Roman, den ich in den letzten zehn Jahren gelesen habe) nur erwähnt, um verständlich zu machen, wie ich auf „Istanbul“, sein nächstes Buch, wartete. Eigentlich konnte ich mir nicht vorstellen, dass ein essayistisches Buch über die eigene Heimatstadt, also ein Text aus einem eher niedrigen, allenfalls journalistischen Genre, ähnlich großartig sein sollte wie ein richtiger Roman.
Understatement ist allerdings gerade der Trick des Buches. Pamuk beginnt, indem er ganz banal über seine Kindheit erzählt, über vorpubertäre Allmachtsphantasien eines weichen Kindes aus gutem Hause – und das Ganze auch noch mit Schnappschüssen aus dem Familienalbum illustriert. Im Folgenden wechseln Familienanekdötchen mit essayistischen Berichten über Istanbulansichten des 19. Jahrhunderts oder Lokalgrößen des Istanbuler Kulturlebens von anno dazumal. Einmal versteigt er sich sogar zu einer Beschreibung der speziell Istanbuler Melancholie in Form einer seitenlangen Aufzählung trauriger Dinge.
Erst nach 200 Seiten, der Hälfte des Buches, wenn alle politikfixierten Leser unweigerlich vergrault sind, lässt er die Katze aus dem Sack: Natürlich war das nicht naiv, sondern sehr bewusst politisch, dass er die finanziellen Verhältnisse seiner Familie, ihre konkreten Lebensgewohnheiten und Ansichten offen darlegt. Und es war auch kein sentimentales Sich-Verlieren, wenn er die malerischen Brände von alten Holzpalästen breit ausmalte, die er als Kind erlebt hat, oder die Autofahrten der Familie an den Bosporus. Er erzählt exemplarisch von sich: „So funktioniert das Leben bei uns.“ – um aufzuklären, nicht um irgendjemanden zu denunzieren (wie Aufklärung heute ja oft missverstanden wird). Die spielerischen Ausflüge in die Kulturgeschichte nutzt er dabei elegant, um historisch wie sozial über das Fallbeispiel seiner Familie hinauszuweisen.
In der zweiten Hälfte des Buches wird diese aufklärerische Absicht wie gesagt offensichtlich, so sehr sogar, dass sie auch in die Kapitelüberschriften Eingang findet: „Eroberung oder Fall? Die Türkisierung Konstantinopels“ oder gleich darauf „Religion“. Immer aber verankert er allgemeinere Aussagen im eigenen Erleben. Zum Beispiel erwähnt er unter „Türkisierung“ zwar die Zwänge des NATO-Mitglieds Türkei und ihrer Regierung in den fünfziger Jahren angesichts der Zypernkrise, ihr Schwanken zwischen Kuschen vor dem Westen und heimlicher Aufhetzung der eigenen Bevölkerung. Aber das ist nicht das Thema, das ist nur notwendige Hintergrundinformation. Das Thema ist, was dann tatsächlich in Istanbul los war und was er erlebt hat: die antigriechischen Pogrome. Oder er schildert seine pubertätstypischen Verrenkungen in Bezug auf die Religion (Wie streng soll man den Ramadan einhalten?), und plötzlich spürt man, das ist ja gar nicht allein sein Problem, das ist ja die Widersprüchlichkeit der ganzen Gesellschaft in religiösen Dingen.
Und überhaupt: „Fremd in einer ausländischen Schule“ heißt eine der schönsten Kapitelüberschriften. Aber wer ist hier gemeint? Orhan Pamuk oder Istanbul? Oder die ganze Türkei? Für diese mehrdeutigen Überschriften liebe ich dieses Buch. Denn sie zeigen den Sinn, den es überhaupt hat, über Politik nachzudenken: Ich lebe in der Welt, und deshalb möchte ich wissen, wie sie ist. Und was ich herausgefunden habe, das will ich auch sagen.
In Vorbereitung dieses Textes las ich in der Wikipedia, und da stand, dass manche Leser Pamuks kritische Ausführungen über die Türkei zum Anlass nahmen zu sagen: Na also, und so ein Land will nun in die EU. Was für ein Denkfehler! Dass wir keine solchen Bücher wie „Schnee“ oder „Istanbul“ haben, das liegt doch nicht daran, dass es in unserm Land nichts zu kritisieren gäbe – es liegt daran, dass wir keinen Orhan Pamuk haben!
Mir jedenfalls ist der Mann ein Vorbild: Er lässt sich nicht davon beirren, dass seine Aussagen (von seinen Befürwortern wie von seinen Gegnern) natürlich politisch missbraucht werden. Und lässt sich davon auch nicht hinreißen, sich in irgendwelche politischen Kämpfe einzuordnen. Sondern bleibt bei sich. Die letzte Kapitelüberschrift in „Istanbul“ lautet: „Ein Gespräch mit meiner Mutter: Geduld, Vorsicht, Kunst“.
... link (2 Kommentare) ... comment
Freitag, 15. Februar 2008
Auch die Nazizeit eignet sich gut für Gruselgeschichten
damals, 00:00h
Zu meinem Geburtstag kurz vor Weihnachten bekam ich ein Buch geschenkt: „Der Junge im gestreiften Pyjama“ von John Boyne, einem jungen irischen Schriftsteller, der – wie der Klappentext vermerkt – Kreatives Schreiben studiert hat. Diese Creative-Writing-Bücher sind ja wie Kartoffelchips: Man kann einfach nicht aufhören. Also war ich nach wenigen Tagen durch – und platt vor Staunen, wie unbekümmert um historische Fakten man sich eines historischen Stoffs bedienen kann, offenbar weil NS und Auschwitz einfach den wirkungsvollsten Schockeffekt versprechen.
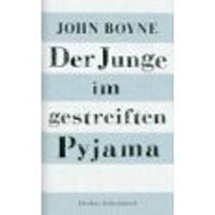
Als ich zu lesen begann, wusste ich noch nichts über das Buch. Aber schon nach wenigen Seiten schwante mir, dass es um die Nazizeit gehen könnte, da der Schauplatz Berlin war und die Figuren altertümliche deutsche Namen hatten. Zwar hieß die Hauptfigur untypisch deutsch Bruno. Damit wurde ihr gutes Herz angedeutet, während die böse Schwester mit dem Namen „Gretel“ gleich als Nazisse gekennzeichnet war (wie es in der Folge der „Todesfuge“ Klischee geworden ist). Aber mit der Nazizeit nicht genug – es ging gleich auch noch um Auschwitz: Der neunjährige Bruno und die zwölfjährige Gretel müssen überraschend packen, weil ihr Vater Kommandant von Auschwitz wird. Zuvor hatten sie in Berlin in einer Villa und abseits der sozialen und ideologischen Realität eine Reiche-Leute-Kindheit verbracht, die eher an die Familie eines hohen Staatsbeamten als an die eines SS-Offiziers denken ließ.
Merkwürdig auch die Ankunft in Auschwitz: Bruno und Gretel wussten nicht, wer gegenüber der Kommandantenvilla eingezäunt wohnt. Sie mutmaßten sogar, es könnte sich um Bauern handeln. Offenbar hatten sie bisher weder je einen Bauern gesehen noch waren sie mit der Blut-und-Boden-Ideologie und ihrer Bauernromantik irgendwie in Berührung gekommen. Auch dass es Juden gibt und was sie sind, war ihnen offensichtlich nicht klar.
War das Buch bis zu dieser Stelle nur äußerst unglaubwürdig, kippt es in der zweiten Hälfte völlig ins Surreale. Bruno schlendert am Zaun entlang und lernt ein einem Häftlingsjungen kennen. Unbemerkt vom Wachpersonal entwickelt sich eine intensive Freundschaft am Zaun. Gedrängt von der Sehnsucht, aus seinem behüteten, aber lieblosen Zuhause auszubrechen, lässt sich Bruno von seinem neuen Freund eine Häftlingsuniform besorgen, schlüpft durch den Zaun. Glücklich spaziert Bruno mit seinem Freund durchs Lager und endlich direkt in die Gaskammer.
In der Kommandantenvilla versteht niemand, wo Bruno abgeblieben ist. Aber über der Trauer zerbricht die Ehe. Die Mutter kehrt mit Gretel zurück in ihr Reiche-Leute-Berlin. Der Vater bleibt in Auschwitz, sinniert über Brunos am Zaun aufgefundene Kleidung, versteht und bereut. Bald darauf wird er verhaftet, folgt also seinem Sohn auf die Seite der Guten, der Unterdrückten.
So weit, so absurd. Natürlich war ich, der Rationalist in mir, zuerst wütend, wie man sich einen solchen Schwachsinn ausdenken kann. Immerhin hab ich auch mal Geschichte studiert, und dieses komplette Ignorieren der historischen Wirklichkeit, das tut mir einfach weh. Dann fragte ich mich, was der Autor eigentlich sagen wollte. Vieles in dem Buch deutet darauf hin, dass er eine Allgemeingültigkeit anstrebt, die über Auschwitz hinausweist. Und wenn man es ganz allgemein nimmt, ergibt das Ganze ja durchaus Sinn. Ja, es gibt vielerorts reiche Kinder, die so vollständig von der sozialen Realität in ihrem Land ferngehalten werden, wie Bruno und Gretel, Kinder, die allein mit der Mama und dem Dienstmädchen in einer Fantasiewelt leben, während der Papa draußen sein Ich für die Karriere verkauft. Und noch allgemeiner gesprochen, gilt das nicht nur für die reichen Kinder, sondern für alle, die in der traditionellen bürgerlichen Familienidyll-Ideologie aufwachsen. Wenn ein Jugendbuch diese Kinder ermuntert, an den Zaun zu gehen und zu fragen, wer dahinter wohnt, ist das an sich eine gute Sache.
Nur hat das nichts mit den Kindern der Nazizeit zu tun – die wurden ja im Gegenteil mit Politik und Ideologie geradezu überschüttet. Und vielleicht eignet sich die Nazizeit ja gerade auch deshalb so gut als das absolute Böse – weil sie so wenig mit unserer (westlich aufgeklärten) Lebenskultur, unseren Überzeugungen, unseren Leichen im Keller zu tun hat.
Aber diese kleinen Unterschiede scheinen dem Autor vernachlässigenswert. Die da oben sind die Bösen, die da unten sind die armen Unterdrückten, und wenn man soziale Ungerechtigkeit anprangern will, dann tut man das am besten, indem man mit den Begriffen Nationalsozialismus und Auschwitz operiert. Denn das verspricht den stärksten Effekt. Und der Effekt ist allemal wichtiger als die gedankliche Stimmigkeit, der Erfolg beweist das - das Internet ist voll von begeisterten Teenagern, die glauben, „Der Junge im gestreiften Pyjama“ handle tatsächlich von der Nazizeit.
....
und demnächst: als Ausgleich eine positive Buchkritik zum Thema Vergangenheitsbewältigung (aber ich verrate noch nicht, was es ist)
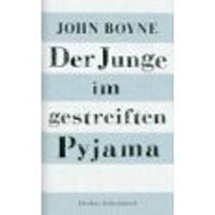
Als ich zu lesen begann, wusste ich noch nichts über das Buch. Aber schon nach wenigen Seiten schwante mir, dass es um die Nazizeit gehen könnte, da der Schauplatz Berlin war und die Figuren altertümliche deutsche Namen hatten. Zwar hieß die Hauptfigur untypisch deutsch Bruno. Damit wurde ihr gutes Herz angedeutet, während die böse Schwester mit dem Namen „Gretel“ gleich als Nazisse gekennzeichnet war (wie es in der Folge der „Todesfuge“ Klischee geworden ist). Aber mit der Nazizeit nicht genug – es ging gleich auch noch um Auschwitz: Der neunjährige Bruno und die zwölfjährige Gretel müssen überraschend packen, weil ihr Vater Kommandant von Auschwitz wird. Zuvor hatten sie in Berlin in einer Villa und abseits der sozialen und ideologischen Realität eine Reiche-Leute-Kindheit verbracht, die eher an die Familie eines hohen Staatsbeamten als an die eines SS-Offiziers denken ließ.
Merkwürdig auch die Ankunft in Auschwitz: Bruno und Gretel wussten nicht, wer gegenüber der Kommandantenvilla eingezäunt wohnt. Sie mutmaßten sogar, es könnte sich um Bauern handeln. Offenbar hatten sie bisher weder je einen Bauern gesehen noch waren sie mit der Blut-und-Boden-Ideologie und ihrer Bauernromantik irgendwie in Berührung gekommen. Auch dass es Juden gibt und was sie sind, war ihnen offensichtlich nicht klar.
War das Buch bis zu dieser Stelle nur äußerst unglaubwürdig, kippt es in der zweiten Hälfte völlig ins Surreale. Bruno schlendert am Zaun entlang und lernt ein einem Häftlingsjungen kennen. Unbemerkt vom Wachpersonal entwickelt sich eine intensive Freundschaft am Zaun. Gedrängt von der Sehnsucht, aus seinem behüteten, aber lieblosen Zuhause auszubrechen, lässt sich Bruno von seinem neuen Freund eine Häftlingsuniform besorgen, schlüpft durch den Zaun. Glücklich spaziert Bruno mit seinem Freund durchs Lager und endlich direkt in die Gaskammer.
In der Kommandantenvilla versteht niemand, wo Bruno abgeblieben ist. Aber über der Trauer zerbricht die Ehe. Die Mutter kehrt mit Gretel zurück in ihr Reiche-Leute-Berlin. Der Vater bleibt in Auschwitz, sinniert über Brunos am Zaun aufgefundene Kleidung, versteht und bereut. Bald darauf wird er verhaftet, folgt also seinem Sohn auf die Seite der Guten, der Unterdrückten.
So weit, so absurd. Natürlich war ich, der Rationalist in mir, zuerst wütend, wie man sich einen solchen Schwachsinn ausdenken kann. Immerhin hab ich auch mal Geschichte studiert, und dieses komplette Ignorieren der historischen Wirklichkeit, das tut mir einfach weh. Dann fragte ich mich, was der Autor eigentlich sagen wollte. Vieles in dem Buch deutet darauf hin, dass er eine Allgemeingültigkeit anstrebt, die über Auschwitz hinausweist. Und wenn man es ganz allgemein nimmt, ergibt das Ganze ja durchaus Sinn. Ja, es gibt vielerorts reiche Kinder, die so vollständig von der sozialen Realität in ihrem Land ferngehalten werden, wie Bruno und Gretel, Kinder, die allein mit der Mama und dem Dienstmädchen in einer Fantasiewelt leben, während der Papa draußen sein Ich für die Karriere verkauft. Und noch allgemeiner gesprochen, gilt das nicht nur für die reichen Kinder, sondern für alle, die in der traditionellen bürgerlichen Familienidyll-Ideologie aufwachsen. Wenn ein Jugendbuch diese Kinder ermuntert, an den Zaun zu gehen und zu fragen, wer dahinter wohnt, ist das an sich eine gute Sache.
Nur hat das nichts mit den Kindern der Nazizeit zu tun – die wurden ja im Gegenteil mit Politik und Ideologie geradezu überschüttet. Und vielleicht eignet sich die Nazizeit ja gerade auch deshalb so gut als das absolute Böse – weil sie so wenig mit unserer (westlich aufgeklärten) Lebenskultur, unseren Überzeugungen, unseren Leichen im Keller zu tun hat.
Aber diese kleinen Unterschiede scheinen dem Autor vernachlässigenswert. Die da oben sind die Bösen, die da unten sind die armen Unterdrückten, und wenn man soziale Ungerechtigkeit anprangern will, dann tut man das am besten, indem man mit den Begriffen Nationalsozialismus und Auschwitz operiert. Denn das verspricht den stärksten Effekt. Und der Effekt ist allemal wichtiger als die gedankliche Stimmigkeit, der Erfolg beweist das - das Internet ist voll von begeisterten Teenagern, die glauben, „Der Junge im gestreiften Pyjama“ handle tatsächlich von der Nazizeit.
....
und demnächst: als Ausgleich eine positive Buchkritik zum Thema Vergangenheitsbewältigung (aber ich verrate noch nicht, was es ist)
... link (2 Kommentare) ... comment