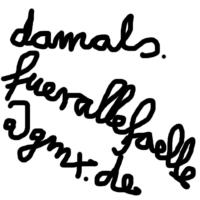Montag, 23. Juni 2025
Geopolitik aus der Froschperspektive
damals, 15:30h
Die großen Kinder spielen mal wieder mit ihren Bomben, und das lächerliche Spiel dieser Jammergestalten könnte uns egal sein, würden sie die Dinger nicht in regelmäßigen Abständen auf die Menschheit niederfallen lassen.
Wenn man von dieser Niedertracht absieht, könnte einem Netanjahu richtig leid tun: Jahrelang konnte er sich auf seine Partner von der Hamas verlassen, die ihm regelmäßig ein paar Raketen über den Zaun schossen, mit denen er seine rassistische Politik legitimieren konnte. Dann aber wurden sie wild und griffen sein Land brutal an.
Das schien Netanjahu im ersten Augenblick nicht das Schlechteste, denn er konnte nun einen triumphalen militärischen Siegeszug durch Gaza inszenieren und so ganz gut von dem Landraub im Westjordanland, der Dekonstruktion der Gewaltenteilung in Israel und nicht zuletzt von seinen persönlichen Konflikten mit den Ermittlungsbehörden ablenken.
Und auch die Hamas war zufrieden, hatten sie doch die humanitäre Katastrophe in Gaza sehnlichst erhofft, die ihnen Netanjahu frei Haus lieferte – sie sicherte der Organisation das politische Überleben.
Ewig geht das aber dennoch nicht gut: Man kann nicht jahrelang hungernde Flüchtlinge hin und her durch ein Trümmerfeld jagen und behaupten, das sei ein erbitterter Krieg gegen übermächtige Feinde, die dem Staat Israel nach dem Leben trachten. Und wiederholte Bitten an den Iran, nun endlich mal einen ordentlichen Krieg anzufangen, wurden dem armen Netanjahu auch abgelehnt – man sah sich in Teheran finanziell dazu nicht in der Lage und wollte lieber bei der herkömmlichen kostengünstigen Variante bleiben und informell über Hisbollah, Revolutionsgarden und Huthi-Rebellen ein bisschen herumstänkern, das schaffe Unruhe genug, um die von allen benötigte Instabilität in der Region aufrecht zu erhalten. Auf dass jeder dieser Idioten sich alle Optionen offen halten und weiter seiner tödlichen Spielsucht frönen kann.
Und außerdem hatte die Hamas noch ein paar propagandistische Trümpfe in der Hand und konnte ziemlich erfolgreich ein paar Verschwörungstheorien etablieren.
Da half es nun alles nichts mehr und Netanjahu musste eben einfach selbstständig einen neuen Krieg beginnen – sehr zum Leidwesen des Irans, dessen Führung mit Putin den Irrtum geteilt hatte, die ständige Drohung mit der Atombombe würde auf alle Zeiten die Gegner kleinhalten.
Nach wie vor der schwächste Player in diesem hässlichen Spiel bleibt dabei der amerikanische Präsidentendarsteller, der so gern den großen Max markieren würde, aber egal ob vor Putin oder vor Netanjahu sofort kuscht, wenn die ihm mal deutlich sagen, was zu lassen und was zu tun ist.
Man könnte lachen über all die Jammerlappen, wenn es nicht zum Weinen wäre.
Wenn man von dieser Niedertracht absieht, könnte einem Netanjahu richtig leid tun: Jahrelang konnte er sich auf seine Partner von der Hamas verlassen, die ihm regelmäßig ein paar Raketen über den Zaun schossen, mit denen er seine rassistische Politik legitimieren konnte. Dann aber wurden sie wild und griffen sein Land brutal an.
Das schien Netanjahu im ersten Augenblick nicht das Schlechteste, denn er konnte nun einen triumphalen militärischen Siegeszug durch Gaza inszenieren und so ganz gut von dem Landraub im Westjordanland, der Dekonstruktion der Gewaltenteilung in Israel und nicht zuletzt von seinen persönlichen Konflikten mit den Ermittlungsbehörden ablenken.
Und auch die Hamas war zufrieden, hatten sie doch die humanitäre Katastrophe in Gaza sehnlichst erhofft, die ihnen Netanjahu frei Haus lieferte – sie sicherte der Organisation das politische Überleben.
Ewig geht das aber dennoch nicht gut: Man kann nicht jahrelang hungernde Flüchtlinge hin und her durch ein Trümmerfeld jagen und behaupten, das sei ein erbitterter Krieg gegen übermächtige Feinde, die dem Staat Israel nach dem Leben trachten. Und wiederholte Bitten an den Iran, nun endlich mal einen ordentlichen Krieg anzufangen, wurden dem armen Netanjahu auch abgelehnt – man sah sich in Teheran finanziell dazu nicht in der Lage und wollte lieber bei der herkömmlichen kostengünstigen Variante bleiben und informell über Hisbollah, Revolutionsgarden und Huthi-Rebellen ein bisschen herumstänkern, das schaffe Unruhe genug, um die von allen benötigte Instabilität in der Region aufrecht zu erhalten. Auf dass jeder dieser Idioten sich alle Optionen offen halten und weiter seiner tödlichen Spielsucht frönen kann.
Und außerdem hatte die Hamas noch ein paar propagandistische Trümpfe in der Hand und konnte ziemlich erfolgreich ein paar Verschwörungstheorien etablieren.
Da half es nun alles nichts mehr und Netanjahu musste eben einfach selbstständig einen neuen Krieg beginnen – sehr zum Leidwesen des Irans, dessen Führung mit Putin den Irrtum geteilt hatte, die ständige Drohung mit der Atombombe würde auf alle Zeiten die Gegner kleinhalten.
Nach wie vor der schwächste Player in diesem hässlichen Spiel bleibt dabei der amerikanische Präsidentendarsteller, der so gern den großen Max markieren würde, aber egal ob vor Putin oder vor Netanjahu sofort kuscht, wenn die ihm mal deutlich sagen, was zu lassen und was zu tun ist.
Man könnte lachen über all die Jammerlappen, wenn es nicht zum Weinen wäre.
... link (2 Kommentare) ... comment
Sonntag, 15. Juni 2025
damals, 17:00h
Ich werde alt, mir leuchten nichtmal mehr die Klischees ein:

Wie kann man einen Bio-Kräutertee "Bremer Werftküche - Deichgold" nennen?
Ich assoziiere dazu Altöl und Schwermetalle. Vielleicht noch mageres, trockenes Gras. Was sonst kann man auf dem Deich hinter der Werftküche ernten?
Sind Regionalität und Heimatgefühle heutzutage schon so gründlich von jeder negativen Assoziation, von jedem Bezug zur Wirklichkeit gereinigt, dass die Käufer sich daran nicht stören?

Wie kann man einen Bio-Kräutertee "Bremer Werftküche - Deichgold" nennen?
Ich assoziiere dazu Altöl und Schwermetalle. Vielleicht noch mageres, trockenes Gras. Was sonst kann man auf dem Deich hinter der Werftküche ernten?
Sind Regionalität und Heimatgefühle heutzutage schon so gründlich von jeder negativen Assoziation, von jedem Bezug zur Wirklichkeit gereinigt, dass die Käufer sich daran nicht stören?
... link (0 Kommentare) ... comment
Montag, 9. Juni 2025
Gedanken über Warnschüsse
damals, 10:42h
Ältere Ossis unter uns (falls es welche gibt) erinnern sich vielleicht noch an die Seite 2 im „Neuen Deutschland“, als es noch das „Zentralorgan“ war. Da gab es immer die Innenpolitik und da gab es manchmal bemerkenswerte Meldungen, zum Beispiel unter der Überschrift „Behauptungen westlicher Medien über xyz entsprechen nicht der Wahrheit“. Wer dann die westlichen Medien nicht konsumiert hatte, der erfuhr nichts, er bekam nur demonstriert: Du erfährst nichts, und das ist auch gut so.
Ein anderes Mal hieß es: „Im Zuge der Verfolgung eines Straftäters wurden im Bereich des des Hermsdorfer Autobahnkreuzes durch Angehörige der Sowjetarmee Warnschüsse abgefeuert. Um die Verkehrssicherheit nicht zu gefährden, wurde das Autobahnkreuz gesperrt.“ Dass der Gewarnte am Ende tot war, war dem ND-Leser damit klar, dass es sich um einen desertierten Sowjetsoldaten gehandelt hatte, konnte er durch einfache Kombination erschließen. Die Rede von den Warnschüssen war also keine in Täuschungsabsicht gemachte Lüge. Sie diente dazu, dem DDR-treuen Leser eine Ausrede bereitzustellen, vielleicht sogar dazu, gleichzeitig dem russischen Besatzer rhetorisch eins auszuwischen.
Dieser Tage höre ich wieder von Warnschüssen, in Gaza, und wieder sind die Gewarnten zuverlässig tot, und kann es sich bei der Rede über Warnschüsse nicht um eine Vertuschung der Wahrheit handeln, denn die Wahrheit liegt ja offen zu Tage. Nicht anders in Charkiw, wo die Rede ist von Angriffen auf militärische Ziele, aber was dann in Flammen aufgeht, das sind Wohnblocks.
In beiden Fällen ist es kein täuschendes Lügen, es ist eine Verhöhnung der Wahrheit, die Angst und Schrecken verbreiten soll. Mit Faktenchecks dagegen angehen zu wollen wäre lächerlich.
Und in beiden Fällen begleiten die Reden ein staatlich organisiertes rassistisches Vorgehen zur Dezimierung eines Nachbarvolks. Eigentlich kein Unterschied. Außer diesem: In der Ukraine unterstützt Deutschland das angegriffene Volk. In Gaza unterstützt es die Aggressoren.
-
P.S. „Was kritzelst du denn da am Montagmorgen?“ fragt meine Frau neben mir im Bett. Ich erkläre ihr, was ich da schreibe. „Das verstehe ich nicht, was du da groß schreiben willst. Das versteht doch jeder. Das ist Krieg. Das heißt: Wir machen euch fertig!“
Ein anderes Mal hieß es: „Im Zuge der Verfolgung eines Straftäters wurden im Bereich des des Hermsdorfer Autobahnkreuzes durch Angehörige der Sowjetarmee Warnschüsse abgefeuert. Um die Verkehrssicherheit nicht zu gefährden, wurde das Autobahnkreuz gesperrt.“ Dass der Gewarnte am Ende tot war, war dem ND-Leser damit klar, dass es sich um einen desertierten Sowjetsoldaten gehandelt hatte, konnte er durch einfache Kombination erschließen. Die Rede von den Warnschüssen war also keine in Täuschungsabsicht gemachte Lüge. Sie diente dazu, dem DDR-treuen Leser eine Ausrede bereitzustellen, vielleicht sogar dazu, gleichzeitig dem russischen Besatzer rhetorisch eins auszuwischen.
Dieser Tage höre ich wieder von Warnschüssen, in Gaza, und wieder sind die Gewarnten zuverlässig tot, und kann es sich bei der Rede über Warnschüsse nicht um eine Vertuschung der Wahrheit handeln, denn die Wahrheit liegt ja offen zu Tage. Nicht anders in Charkiw, wo die Rede ist von Angriffen auf militärische Ziele, aber was dann in Flammen aufgeht, das sind Wohnblocks.
In beiden Fällen ist es kein täuschendes Lügen, es ist eine Verhöhnung der Wahrheit, die Angst und Schrecken verbreiten soll. Mit Faktenchecks dagegen angehen zu wollen wäre lächerlich.
Und in beiden Fällen begleiten die Reden ein staatlich organisiertes rassistisches Vorgehen zur Dezimierung eines Nachbarvolks. Eigentlich kein Unterschied. Außer diesem: In der Ukraine unterstützt Deutschland das angegriffene Volk. In Gaza unterstützt es die Aggressoren.
-
P.S. „Was kritzelst du denn da am Montagmorgen?“ fragt meine Frau neben mir im Bett. Ich erkläre ihr, was ich da schreibe. „Das verstehe ich nicht, was du da groß schreiben willst. Das versteht doch jeder. Das ist Krieg. Das heißt: Wir machen euch fertig!“
... link (0 Kommentare) ... comment
Montag, 26. Mai 2025
Serhij Zhadan über Werte der Freiheit
damals, 13:26h
Angesprochen auf Donald Trumps Vorschlag zu Beendigung des Ukraine-Kriegs, sagte Serhij Zhadan am 22.03.2025 in der FAZ: "Das ist zweifellos sehr demotivierend und untergräbt die Idee von Ehrlichkeit und Gerchtigkeit.Andererseits zeigen uns solche Entwicklungen, dass wir uns in der Konfrontation mit dem Aggressor in erster Linie auf uns selbst verlassen müssen. Und dass wir mit unseren europäischen und amerikanischen Verbündeten über die Werte der Freiheit sprechen müssen und nicht über den materiell motivierten Wunsch, am Unglück anderer zu verdienen."
Er spricht hier nicht nur über Trump, der den Ukrainekrieg nutzt, um sich ukrainische Bodenschätze zu sichern. Er spricht auch über europäische Verbündete, die die Ukraine erst (2022) durch großspurige Unterstützungsversprechen verleitet haben, die Verhandlungen mit dem damals noch von der Gegenwehr überraschten und vielleicht verhandlungsbereiten Russland nicht fortzuführen, denen dann aber außer Waffenlieferungen (an denen ihre Firmen verdienen) rein gar nichts eingefallen ist.
P.S. Verstehen sie mich nicht falsch: Ich bin für Waffenlieferungen an die Ukraine - natürlich, die Ukraine braucht die Waffen, wenn sie als Staat überleben will. Aber ich bin auch für eine Übergewinnsteuer für Rheinmetall. Ich bin auch dafür, die Tanker der russischen Schattenflotte zu stoppen (Putin ist da nicht so zimperlich, mit dem Festsetzen fremder Tanker, wie er uns dieser Tage demonstriert:)
https://www.n-tv.de/politik/Jan-van-Aken-erzaehlt-von-seiner-Rheinmetall-Aktie-article25759015.html
Er spricht hier nicht nur über Trump, der den Ukrainekrieg nutzt, um sich ukrainische Bodenschätze zu sichern. Er spricht auch über europäische Verbündete, die die Ukraine erst (2022) durch großspurige Unterstützungsversprechen verleitet haben, die Verhandlungen mit dem damals noch von der Gegenwehr überraschten und vielleicht verhandlungsbereiten Russland nicht fortzuführen, denen dann aber außer Waffenlieferungen (an denen ihre Firmen verdienen) rein gar nichts eingefallen ist.
P.S. Verstehen sie mich nicht falsch: Ich bin für Waffenlieferungen an die Ukraine - natürlich, die Ukraine braucht die Waffen, wenn sie als Staat überleben will. Aber ich bin auch für eine Übergewinnsteuer für Rheinmetall. Ich bin auch dafür, die Tanker der russischen Schattenflotte zu stoppen (Putin ist da nicht so zimperlich, mit dem Festsetzen fremder Tanker, wie er uns dieser Tage demonstriert:)
https://www.n-tv.de/politik/Jan-van-Aken-erzaehlt-von-seiner-Rheinmetall-Aktie-article25759015.html
... link (0 Kommentare) ... comment
Mittwoch, 30. April 2025
Lieblingslyriker
damals, 23:19h
Als ich noch im 20. Jahrhundert lebte und tief verwurzelt war in der Betonhaftigkeit und dem Kulturpessimismus dieses Jahrhunderts, da glaubte ich, nach dem großen Brecht, da sei niemand mehr gekommen in Deutschland, der großartige Lyrik verfasst hat. Und doch liebte ich insgeheim schon Bachmann für ihre Klugheit, ihr tiefes Gefühl und hatte meine Freude an den virtuosen Spielerien von Jandl.
Erst tief im 21. Jahrhundert entdeckte ich Brinkmann und Hilbig und jetzt fällt mir auf, dass ich auch von Marie T. Martin schon mehrfach Wunderbares gelesen habe. Ich sollte mich wirklich mal darum kümmern, ob sie noch mehr davon verfasst hat. Warum entdeck ich die Lyriker immer erst, wenn ihre Zeit vorbei ist?
Erst tief im 21. Jahrhundert entdeckte ich Brinkmann und Hilbig und jetzt fällt mir auf, dass ich auch von Marie T. Martin schon mehrfach Wunderbares gelesen habe. Ich sollte mich wirklich mal darum kümmern, ob sie noch mehr davon verfasst hat. Warum entdeck ich die Lyriker immer erst, wenn ihre Zeit vorbei ist?
... link (0 Kommentare) ... comment
Mittwoch, 16. April 2025
Unberechtigte Befürchtungen der CDU
damals, 22:51h
Da kommt also ein Flugzeug mit gut hundet Afghanen nach Deutschland, Menschen, die sich dort für Menschenrechte eingesetzt oder für die Bundeswehr gearbeitet haben. Aus der CDU kommen Sicherheitsbedenken dagegen.
Ist es denn wirklich zu fürchten, dass sich allein dadurch die Zahl der Kämpfer für die Menschenrechte in Deutschland so sehr erhöhen wird, dass die nationale Sicherheit gefährdet ist?
Und auch der Freundeskreis der Bundeswehr dürften durch diese Zuwanderung nicht übermäßig anwachsen. wo ist das Problem?
Ist es denn wirklich zu fürchten, dass sich allein dadurch die Zahl der Kämpfer für die Menschenrechte in Deutschland so sehr erhöhen wird, dass die nationale Sicherheit gefährdet ist?
Und auch der Freundeskreis der Bundeswehr dürften durch diese Zuwanderung nicht übermäßig anwachsen. wo ist das Problem?
... link (1 Kommentar) ... comment
Zur Wortwahl der Tagesschau
damals, 22:44h
Die Tagesschau meldet heute, ein "mutmaßlich rechtsextremer" Mensch habe der Bürgermeisterin von Zwickau mit Verweis auf Lübcke den Tod angedroht. Wieso eigentlich "mutmaßlich"? Weil die direkte Auftraggeberschaft durch Höcke, Sellner, Kubitschek oder die AFD-Führung noch nicht gerichtsfest nachgewiesen wurde? Darf wirklich nur der als politich motivierter Extremist gelten, der auch das passende Parteibuch in der Tasche hat wie einst Marius van der Lubbe?
Die Bürgermeisterin meinte, es könne sich eventuell einfach um einen Spinner handeln. Gut möglich. Aber dann doch wohl um einen rechtsextremen Spinner.
Die Bürgermeisterin meinte, es könne sich eventuell einfach um einen Spinner handeln. Gut möglich. Aber dann doch wohl um einen rechtsextremen Spinner.
... link (2 Kommentare) ... comment
Samstag, 12. April 2025
Ein Buch über Anna Seghers
damals, 13:03h
Das hat meine Frau billig irgendwo gekauft, und das interessierte mich auch, und so haben wir es gleichzeitig gelesen: über Anna Seghers’ Zeit nach 1945 in Berlin. Denn dass Anna Seghers, die großartige Schriftstellerin (ich kenne von ihr „Transit“, „Das siebte Kreuz“ und „Ausflug der toten Mädchen“), dann eine kreuzbrave Verfasserin stalinistischer Romane und Vorsitzende eines autoritär agierenden Schriftstellerverbands geworden sein soll, wie es die allgemeine Rede ist, daran kann ja irgendetwas nicht stimmen – oder wenn doch, dann müsste das doch spannend sein, „wie das möglich, ja, dass es überhaupt geschah“. (Morgenstern: Die unmögliche Tatsache)
Also zunächst die Fakten, die das Buch (Monika Melchert: Heimkehr in ein kaltes Land). Anna Seghers in Berlin) kenntnisreich und detailliert darstellt: Anna Seghers ist 1947 aus dem mexikanischen Exil nach Berlin zurückgegangen wie in eine Falle. Nachdem die Kinder 45/46 zum Studium nach Paris gegangen waren, stand auch für die Eltern die Rückkehr nach Europa an – Anna Seghers sollte nach Berlin vorangehen, ihr Mann wollte positivenfalls folgen. Was er dann aber nicht tat. Er blieb in Mexiko, wo er mit seiner Geliebten eine feste Bindung einging. Anna Seghers war in Berlin allein, wohnte zunächst im Westteil, behielt ihren mexikanischen Pass. Im selben Jahr traf sie ihre Freunde Brecht und Weigel in Paris, die auch erwogen, nach Ostberlin zu gehen. Brecht resümierte das Gespräch und den aktuellen Bericht seiner Freundin Seghers knapp, mit der Entscheidung, dass das nur mit ausländischem Pass denkbar ist. Seghers aber sich ließ von der Partei bequatschen und umwerben, tauschte die mexikanische gegen die DDR-Staatsbürgerschaft, zog nach Ostberlin und war ab da gefangen in ihrer Rolle als große kommunistische Schriftstellerin, die sie nun zu spielen hatte. Nun folgte auch ihr Mann, als er eine Professur für „Probleme des Imperialismus“ an der Humboldt-Uni bekam. Seine Geliebte brachte er mit, und er schrieb fleißig Denunziantenberichte für Partei und Stasi (wie er es schon in Mexiko für den sowjetischen Nachrichtendienst getan hatte) und er korrigierte – als Anna sich brav an die geforderten stalinistischen Romane machte – auch in ihre schriftstellerische Arbeit rein. Anna Seghers machte mit und hielt die Klappe. Später schrieb sie so gut wie gar nichts mehr.
So weit zum Inhalt des Buches.
Aber die Schreibweise: meine Güte! Also, zunächst mal fand ich verblüffend, wie unpolitisch oder politisch ahnungslos die Autorin über so ein hochpolitisches Thema schreibt. Zum Beispiel an der Stelle, wo sie Seghers` Probleme mit der Partei von 1947 thematisiert und dann meint, das sei auch 1951 noch nicht besser geworden. Noch nicht besser?! Jeder, der ein bisschen DDR-Geschichte kennt, und wenn er auch nur im Staatsbürgerkundeunterricht damals aufgepasst hat, der weiß doch, dass es 1951 natürlich schlimmer war als 1947. „Ja, das weißt du!“, meinte meine Frau, „aber die ist doch jung und weiß das nicht, das merkst du doch an ihrer ungelenken Schreibweise, manchmal wiederholt sich etwas, manchmal wirkt es ein bisschen naiv.“
Aber dann fielen mir doch Stellen auf, wo die Autorin schon zeigt, dass sie die politischen Zustände von damals kennt, nur wischt sie sie eben so im Nebensatz weg. Also googelte ich nach: Die Autorin ist keineswegs jung, sogar älter als ich, sie hat in den 70er Jahren in der DDR Germanistik studiert, promoviert und in Berlin als Literaturwissenschaftlerin gearbeitet. Eine rote Socke, die die Verhältnisse sehr gut kennt, nur nicht wahrhaben will. Und der Spruch, es sei 1951 „noch nicht“ besser geworden, nichts als eine Wiederholung der alten DDR-Lüge, alle Probleme der Gesellschaft hätten ihren Grund darin, dass der Sozialismus eben noch nicht so weit sei, wie er sein müsse, dass wir noch mehr an ihm und an uns arbeiten müssten blablabla.
Genauso im Privaten: Sie legt einen spießigen, kitschigen Feminismus an den Tag, der mehr vertuscht, als er aufklärt, der eigentlich ein Antifeminismus ist. „Also, mit Feminismus hat das nun gar nichts zu tun, wie die schreibt.“, protestierte meine Frau. Aber wie soll man das nennen? Bei ihr halten die Frauen immer zusammen und verstehen sich gut. Aber wovon sie reden, davon erfährt man nichts. Und es wird immer wieder betont, dass die Kinderaufzucht die Frauen so sehr belastet. Was aber mit den Männern ist, davon kein Wort. Die Männer werden durchweg als die „Liebsten“ ihrer Frauen bezeichnet. Das klingt zunächst ein bisschen süßlich, im Grunde aber verdeckt es die Art der jeweiligen Beziehung (Sind sie nun Ehemänner, Lebensgefährten, Geliebte oder was?). Es zeigt die Angst davor, irgendwas über die Struktur der jeweiligen Beziehung, über Verantwortlichkeiten, über strukturelle Diskriminierungen usw. auszusagen.
Und auch alles, was ich oben an „Fakten“ aufgeschrieben habe, sind natürlich schon meine Interpretationen des Gelesenen, die Autorin hätte das nie so klar ausgesprochen. Immer sich klein machen, das nette Mädchen von nebenan spielen und über jedes Problem bewusst hinwegsehen.
Das ist es, was mich immer wieder entsetzt, dieses Unerwachsene, gespielt Naive, Nett-Kitschige dieser roten Socken, dem unsereins immer wieder auf den Leim geht.
... und natürlich diese Rote-Socken-Taktik der Nachwendezeit, wo man ja nichts mehr leugnen kann: die jeweils schlimmsten Fakten eben so im Nebensatz zu erwähnen, ohne dass sie irgendwo Eingang in den Gedankengang finden, der rotsockig bleibt wie eh und je - für den Fall, dass einem jemand an den Wagen fährt, damit man sagen kann: Aber ich habs doch gesagt, ich habe es nicht verschwiegen.
Also zunächst die Fakten, die das Buch (Monika Melchert: Heimkehr in ein kaltes Land). Anna Seghers in Berlin) kenntnisreich und detailliert darstellt: Anna Seghers ist 1947 aus dem mexikanischen Exil nach Berlin zurückgegangen wie in eine Falle. Nachdem die Kinder 45/46 zum Studium nach Paris gegangen waren, stand auch für die Eltern die Rückkehr nach Europa an – Anna Seghers sollte nach Berlin vorangehen, ihr Mann wollte positivenfalls folgen. Was er dann aber nicht tat. Er blieb in Mexiko, wo er mit seiner Geliebten eine feste Bindung einging. Anna Seghers war in Berlin allein, wohnte zunächst im Westteil, behielt ihren mexikanischen Pass. Im selben Jahr traf sie ihre Freunde Brecht und Weigel in Paris, die auch erwogen, nach Ostberlin zu gehen. Brecht resümierte das Gespräch und den aktuellen Bericht seiner Freundin Seghers knapp, mit der Entscheidung, dass das nur mit ausländischem Pass denkbar ist. Seghers aber sich ließ von der Partei bequatschen und umwerben, tauschte die mexikanische gegen die DDR-Staatsbürgerschaft, zog nach Ostberlin und war ab da gefangen in ihrer Rolle als große kommunistische Schriftstellerin, die sie nun zu spielen hatte. Nun folgte auch ihr Mann, als er eine Professur für „Probleme des Imperialismus“ an der Humboldt-Uni bekam. Seine Geliebte brachte er mit, und er schrieb fleißig Denunziantenberichte für Partei und Stasi (wie er es schon in Mexiko für den sowjetischen Nachrichtendienst getan hatte) und er korrigierte – als Anna sich brav an die geforderten stalinistischen Romane machte – auch in ihre schriftstellerische Arbeit rein. Anna Seghers machte mit und hielt die Klappe. Später schrieb sie so gut wie gar nichts mehr.
So weit zum Inhalt des Buches.
Aber die Schreibweise: meine Güte! Also, zunächst mal fand ich verblüffend, wie unpolitisch oder politisch ahnungslos die Autorin über so ein hochpolitisches Thema schreibt. Zum Beispiel an der Stelle, wo sie Seghers` Probleme mit der Partei von 1947 thematisiert und dann meint, das sei auch 1951 noch nicht besser geworden. Noch nicht besser?! Jeder, der ein bisschen DDR-Geschichte kennt, und wenn er auch nur im Staatsbürgerkundeunterricht damals aufgepasst hat, der weiß doch, dass es 1951 natürlich schlimmer war als 1947. „Ja, das weißt du!“, meinte meine Frau, „aber die ist doch jung und weiß das nicht, das merkst du doch an ihrer ungelenken Schreibweise, manchmal wiederholt sich etwas, manchmal wirkt es ein bisschen naiv.“
Aber dann fielen mir doch Stellen auf, wo die Autorin schon zeigt, dass sie die politischen Zustände von damals kennt, nur wischt sie sie eben so im Nebensatz weg. Also googelte ich nach: Die Autorin ist keineswegs jung, sogar älter als ich, sie hat in den 70er Jahren in der DDR Germanistik studiert, promoviert und in Berlin als Literaturwissenschaftlerin gearbeitet. Eine rote Socke, die die Verhältnisse sehr gut kennt, nur nicht wahrhaben will. Und der Spruch, es sei 1951 „noch nicht“ besser geworden, nichts als eine Wiederholung der alten DDR-Lüge, alle Probleme der Gesellschaft hätten ihren Grund darin, dass der Sozialismus eben noch nicht so weit sei, wie er sein müsse, dass wir noch mehr an ihm und an uns arbeiten müssten blablabla.
Genauso im Privaten: Sie legt einen spießigen, kitschigen Feminismus an den Tag, der mehr vertuscht, als er aufklärt, der eigentlich ein Antifeminismus ist. „Also, mit Feminismus hat das nun gar nichts zu tun, wie die schreibt.“, protestierte meine Frau. Aber wie soll man das nennen? Bei ihr halten die Frauen immer zusammen und verstehen sich gut. Aber wovon sie reden, davon erfährt man nichts. Und es wird immer wieder betont, dass die Kinderaufzucht die Frauen so sehr belastet. Was aber mit den Männern ist, davon kein Wort. Die Männer werden durchweg als die „Liebsten“ ihrer Frauen bezeichnet. Das klingt zunächst ein bisschen süßlich, im Grunde aber verdeckt es die Art der jeweiligen Beziehung (Sind sie nun Ehemänner, Lebensgefährten, Geliebte oder was?). Es zeigt die Angst davor, irgendwas über die Struktur der jeweiligen Beziehung, über Verantwortlichkeiten, über strukturelle Diskriminierungen usw. auszusagen.
Und auch alles, was ich oben an „Fakten“ aufgeschrieben habe, sind natürlich schon meine Interpretationen des Gelesenen, die Autorin hätte das nie so klar ausgesprochen. Immer sich klein machen, das nette Mädchen von nebenan spielen und über jedes Problem bewusst hinwegsehen.
Das ist es, was mich immer wieder entsetzt, dieses Unerwachsene, gespielt Naive, Nett-Kitschige dieser roten Socken, dem unsereins immer wieder auf den Leim geht.
... und natürlich diese Rote-Socken-Taktik der Nachwendezeit, wo man ja nichts mehr leugnen kann: die jeweils schlimmsten Fakten eben so im Nebensatz zu erwähnen, ohne dass sie irgendwo Eingang in den Gedankengang finden, der rotsockig bleibt wie eh und je - für den Fall, dass einem jemand an den Wagen fährt, damit man sagen kann: Aber ich habs doch gesagt, ich habe es nicht verschwiegen.
... link (0 Kommentare) ... comment
Donnerstag, 27. März 2025
Deutschland-Märchen
damals, 01:15h
Es gab einmal ein Land, in dem gab es zu viel Geld. Also jetzt nicht bei der Regierung, sondern bei den reichen Leuten. Die wurden richtig verrückt, weil sie nicht wussten, was sie mit dem Geld machen sollten. Einige begannen, miteinander Wetten abzuschließen, wessen Geld nun weniger wert wäre. Manche gewannen die Wetten, und dann hatten sie noch mehr Geld und dann mussten sie noch mehr Wetten abschließen.
Andere versuchten, das Geld loszuwerden, indem sie in den Städten Häuser und Grundstücke kauften, die sie gar nicht brauchten, denn sie hatten ja schon welche. Dadurch wurden in den Städten die Häuser und Grundstücke knapp und deshalb teurer, und so hatten sie noch mehr Geld und mussten sich schon wieder was überlegen, was sie mit dem Geld machen. Einige fingen in ihrer Not an, Ackerland zu kaufen, aber sie hatten keine Ahnung, was sie damit anfangen sollten. Also verpachteten sie es an die Bauern, denen sie es abgekauft hatten. Und dann kriegten sie Pacht und also noch mehr Geld.
Die Armen waren neidisch auf die Reichen, aber sie schämten sich es zuzugeben, dass sie auch gerne reich wären. Manche probierten es damit, dass sie ganz viel arbeiteten, um damit viel Geld zu verdienen. Aber irgendwie funktionierte das nicht. Andere versuchten, es den Reichen nachzumachen und gar nicht zu arbeiten, aber das funktionierte auch nicht.
Und die Regierung wollte es allen recht machen. Den Reichen wollte sie kein Geld wegnehmen, um sie nicht zu verärgern, und den Armen gab sie Geld, damit sie nicht so sauer auf die Reichen sind. Dazu musste sich die Regierung Geld von anderswo besorgen, und dadurch war dann noch mehr Geld im Land. Und die Reichen beschwerten sich, dass die Armen einfach so Geld kriegen, und meinten, sie müssten dann auch welches kriegen.
Eigentlich hatte die Regierung ganz was anderes zu tun, denn sie musste die Straßen und die Eisenbahn in Ordnung bringen, die schon ganz schön alt geworden waren. Auch dafür musste sie sich Geld im Ausland besorgen und außerdem noch Arbeiter, die nicht so viel Geld verlangten wie die eigenen Armen. Und dann wurden die eigenen Armen sauer, weil es jetzt noch andere Arme gab. Und dann mussten die neuen Armen natürlich auch ein bisschen Geld von der Regierung kriegen. Irgendwie ging alles schief.
Zu guter Letzt gab es auch noch Stress mit den Nachbarn, und die Regierung brauchte eine Armee, um das Land zu schützen. Die Regierung hatte zwar eine Armee, aber die Soldaten wussten gar nicht mehr, wie man Land verteidigt, weil sie viele Jahre im Ausland gewesen waren. Sie hatten dort dafür sorgen sollen, dass man ihr Land auch in anderen Ländern mehr ernst nimmt, aber das hatte nicht geklappt, denn die Soldaten hatten immer nur den noch stärkeren Ländern helfen müssen und waren von denen noch ausgelacht worden.
Und das zu Recht, denn in diesem Land waren alle auf alle sauer, niemand war bereit, auch nur einen Handschlag für jemand anderen zu tun, und am Ende saßen sie da wie Ilsebill in ihrem umgekippten Nachttopf.
Andere versuchten, das Geld loszuwerden, indem sie in den Städten Häuser und Grundstücke kauften, die sie gar nicht brauchten, denn sie hatten ja schon welche. Dadurch wurden in den Städten die Häuser und Grundstücke knapp und deshalb teurer, und so hatten sie noch mehr Geld und mussten sich schon wieder was überlegen, was sie mit dem Geld machen. Einige fingen in ihrer Not an, Ackerland zu kaufen, aber sie hatten keine Ahnung, was sie damit anfangen sollten. Also verpachteten sie es an die Bauern, denen sie es abgekauft hatten. Und dann kriegten sie Pacht und also noch mehr Geld.
Die Armen waren neidisch auf die Reichen, aber sie schämten sich es zuzugeben, dass sie auch gerne reich wären. Manche probierten es damit, dass sie ganz viel arbeiteten, um damit viel Geld zu verdienen. Aber irgendwie funktionierte das nicht. Andere versuchten, es den Reichen nachzumachen und gar nicht zu arbeiten, aber das funktionierte auch nicht.
Und die Regierung wollte es allen recht machen. Den Reichen wollte sie kein Geld wegnehmen, um sie nicht zu verärgern, und den Armen gab sie Geld, damit sie nicht so sauer auf die Reichen sind. Dazu musste sich die Regierung Geld von anderswo besorgen, und dadurch war dann noch mehr Geld im Land. Und die Reichen beschwerten sich, dass die Armen einfach so Geld kriegen, und meinten, sie müssten dann auch welches kriegen.
Eigentlich hatte die Regierung ganz was anderes zu tun, denn sie musste die Straßen und die Eisenbahn in Ordnung bringen, die schon ganz schön alt geworden waren. Auch dafür musste sie sich Geld im Ausland besorgen und außerdem noch Arbeiter, die nicht so viel Geld verlangten wie die eigenen Armen. Und dann wurden die eigenen Armen sauer, weil es jetzt noch andere Arme gab. Und dann mussten die neuen Armen natürlich auch ein bisschen Geld von der Regierung kriegen. Irgendwie ging alles schief.
Zu guter Letzt gab es auch noch Stress mit den Nachbarn, und die Regierung brauchte eine Armee, um das Land zu schützen. Die Regierung hatte zwar eine Armee, aber die Soldaten wussten gar nicht mehr, wie man Land verteidigt, weil sie viele Jahre im Ausland gewesen waren. Sie hatten dort dafür sorgen sollen, dass man ihr Land auch in anderen Ländern mehr ernst nimmt, aber das hatte nicht geklappt, denn die Soldaten hatten immer nur den noch stärkeren Ländern helfen müssen und waren von denen noch ausgelacht worden.
Und das zu Recht, denn in diesem Land waren alle auf alle sauer, niemand war bereit, auch nur einen Handschlag für jemand anderen zu tun, und am Ende saßen sie da wie Ilsebill in ihrem umgekippten Nachttopf.
... link (2 Kommentare) ... comment
Mittwoch, 5. Februar 2025
DDR-Kunst, wiedergesehen
damals, 14:02h
In Potsdam wurde vor einigen Jahren das Terrassenrestaurant „Minsk“, ein Vorzeigebau der DDR-Moderne, vor dem Abriss gerettet, und zwar durch einen reichen westdeutschen Kunstsammler, den SAP-Mitgründer Hasso Plattner, der die Ruine kaufte, aufwendig renovieren ließ und als Kunsthaus „Das Minsk“ wiedereröffnete. Das Haus sollte sich der Kunstwelt Ostdeutschlands öffnen, wie schon die Eröffnungsausstellung zeigte: eine Doppelschau mit Werken des berühmten Leipziger Malers Wolfgang Mattheuer und des amerikanischen Fotografen Stan Douglas, der sich mit klugen Einblicken in Potsdamer Schrebergärten präsentierte.
Die folgenden Ausstellungen hatten dann meist weniger mit ostdeutscher Kunst zu tun – die beste davon, eine Werkschau des amerikanischen Malers Noah Davis, gar nichts mehr. Es ist zu vermuten, dass das Plattner nicht gefiel, denn kurz darauf verließ die Leiterin Paola Malavassi nach erst 2 Jahren das Haus. Seit dem 2. Februar kann man nun im „Minsk“ zunächst einmal DDR-Kunst aus der Sammlung Plattner sehen, in einer Ausstellung mit dem Titel „Im Dialog“.
Das Konzept der Ausstellung orientiert sich an einem Interview-Band des Kunstkritikers Henry Schumann aus dem Jahr 1976. Schumann hatte versucht, die Bildende Kunst seines Landes als subjektiv und individuell zu präsentieren, indem er KünstlerInnen in langen Interviews zu Wort kommen ließ, und das ausgerechnet in dem berühmten Jahr 1976, als die Kulturpolitik noch einmal repressiver, die staatliche Kontrolle umfassender wurde. Wahrscheinlich hat Schumanns Konzept schon damals nicht funktioniert. Das Minsk zeigt ein entlarvend realistisches Schumann-Portrait von dem Maler Arno Rink. Mit der scharfkantigen Genauigkeit der Leipziger Schule portraitiert dieser das verkniffene Gesicht des Kritikers in einer Atelier-Situation - es wird klar: Ehrlich, frei ging es nicht zu zwischen Kritiker und KünstlerInnen.
Entsprechend vorsichtig, traditionell und privat, geben sich die Bilder der Zeit um 1976: ein eindringlich impressionistisches Interieur mit seiner Frau von Wolfgang Mattheuer, ein stimmungsvoller Blick auf Alexisbad im Harz von Willi Sitte, ein skurril-humoriger Parkspaziergang von Peter Herrmann.
In einem zweiten Raum versucht die Ausstellung, Schumanns Dialog-Idee mit etwas provokanteren Werken aufzugreifen, überwiegend aus der Zeit nach 1976. Offenbar geht es hier darum, zeittypische Positionen, kulturhistorische Zusammenhänge zu verdeutlichen. Die Grundidee dabei: staatsnahe Kunst der staatsskeptischen gegenüberzustellen. Einleuchtend wirkt die Gegenüberstellung jedoch nicht, im Gegenteil. So fragt man sich zum Beispiel, wieso die mit Abstand schärfste Kritik an den realsozialistischen Zuständen ausgerechnet vom anerkannten Staatsmaler Mattheuer kommt, während die Bilder der Widerständigen Kerbach, Schleime, Herrmann ziemlich sprach- und aussagelos wirken. Könnte es vielleicht sein, dass sich gerade in diesen Werken der Zweifler und Angefeindeten der Erfolg der staatlichen Denk- und Sprechverbote am deutlichsten manifestiert?
Dazu würde passen, dass die künstlerisch freiesten unter den Werken der Widerständigen die Mail-Art-Objekte von Wolf-Rehfeld und Schulz sind, die mit ihrem minimalistischen Dadaismus wie unter dem Radar fliegen und deren ausdrückliche Verweigerung von Sinn und Ernst es ihnen ermöglicht, im spielerischen Kritzeln und Herumtippen auf der Schreibmaschine zu einer freien Sinnentfaltung zu kommen.
Jedenfalls machen diese kleinen Objekte Spaß, verströmen einen Geist von Freiheit, der den großen Leinwänden von Kerbach, Ebersbach oder Firit abgeht, die ebenso verkopft und verkrampft daher kommen wie die im selben Raum ausgestellten großen Schinken von Sitte.
Vielleicht gibt es ihn gar nicht, den Gegensatz zwischen Staatskünstlern und Widerständigen – die zeichenhafte, fast comicartig ruppige Malweise zum Beispiel, mit der Mattheuer den „Koloss II“ gestaltet, sie findet sich genauso in Günter Firits „Selbstzerstörung“.
Als ich durch die Ausstellung ging, musste ich zurückdenken an die Gemälde von Noah Davis, die ich vor kurzem in denselben Räumen gesehen habe, auch er ein Widerständiger. Als schwarzer US-Amerikaner malte er wütend gegen Rassismus und soziale Ungerechtigkeit an. Offenbar war es in seinem Land möglich, das klar auszudrücken und zur großen Form werden zu lassen. Bei den DDR-Künstlern der aktuellen Ausstellung des Minsk erlebte ich eher ein unwürdiges Versteckspiel, ein Verstecken hinter intellektuellen Formeln wie bei Mattheuer, hinter aufgesetztem Pathos wie bei Ebersbach und Sitte oder in einem nebulösen Irgendwo wie bei Händler.
Ich verließ die Ausstellung mit einem Gefühl von Kälte und Tristesse. War die DDR-Kunst wirklich so trostlos oder ist das dem persönlichen Geschmack und der Ankaufpolitik des Mäzens zu verdanken? Oder gar der Auswahl des Kurators Daniel Milnes aus Plattners doch umfangreicher Sammlung? Und wieso sammelt ein reicher Unternehmer aus dem Westen überhaupt mit solcher Ausdauer diese Kunst und errichtet ihr sogar ein eigenes Museum?
Vielleicht werden uns ja die kommenden Minsk-Ausstellungen unter der neuen Leitung Aufschluss darüber geben. Das könnte dann noch spannend werden.
Die folgenden Ausstellungen hatten dann meist weniger mit ostdeutscher Kunst zu tun – die beste davon, eine Werkschau des amerikanischen Malers Noah Davis, gar nichts mehr. Es ist zu vermuten, dass das Plattner nicht gefiel, denn kurz darauf verließ die Leiterin Paola Malavassi nach erst 2 Jahren das Haus. Seit dem 2. Februar kann man nun im „Minsk“ zunächst einmal DDR-Kunst aus der Sammlung Plattner sehen, in einer Ausstellung mit dem Titel „Im Dialog“.
Das Konzept der Ausstellung orientiert sich an einem Interview-Band des Kunstkritikers Henry Schumann aus dem Jahr 1976. Schumann hatte versucht, die Bildende Kunst seines Landes als subjektiv und individuell zu präsentieren, indem er KünstlerInnen in langen Interviews zu Wort kommen ließ, und das ausgerechnet in dem berühmten Jahr 1976, als die Kulturpolitik noch einmal repressiver, die staatliche Kontrolle umfassender wurde. Wahrscheinlich hat Schumanns Konzept schon damals nicht funktioniert. Das Minsk zeigt ein entlarvend realistisches Schumann-Portrait von dem Maler Arno Rink. Mit der scharfkantigen Genauigkeit der Leipziger Schule portraitiert dieser das verkniffene Gesicht des Kritikers in einer Atelier-Situation - es wird klar: Ehrlich, frei ging es nicht zu zwischen Kritiker und KünstlerInnen.
Entsprechend vorsichtig, traditionell und privat, geben sich die Bilder der Zeit um 1976: ein eindringlich impressionistisches Interieur mit seiner Frau von Wolfgang Mattheuer, ein stimmungsvoller Blick auf Alexisbad im Harz von Willi Sitte, ein skurril-humoriger Parkspaziergang von Peter Herrmann.
In einem zweiten Raum versucht die Ausstellung, Schumanns Dialog-Idee mit etwas provokanteren Werken aufzugreifen, überwiegend aus der Zeit nach 1976. Offenbar geht es hier darum, zeittypische Positionen, kulturhistorische Zusammenhänge zu verdeutlichen. Die Grundidee dabei: staatsnahe Kunst der staatsskeptischen gegenüberzustellen. Einleuchtend wirkt die Gegenüberstellung jedoch nicht, im Gegenteil. So fragt man sich zum Beispiel, wieso die mit Abstand schärfste Kritik an den realsozialistischen Zuständen ausgerechnet vom anerkannten Staatsmaler Mattheuer kommt, während die Bilder der Widerständigen Kerbach, Schleime, Herrmann ziemlich sprach- und aussagelos wirken. Könnte es vielleicht sein, dass sich gerade in diesen Werken der Zweifler und Angefeindeten der Erfolg der staatlichen Denk- und Sprechverbote am deutlichsten manifestiert?
Dazu würde passen, dass die künstlerisch freiesten unter den Werken der Widerständigen die Mail-Art-Objekte von Wolf-Rehfeld und Schulz sind, die mit ihrem minimalistischen Dadaismus wie unter dem Radar fliegen und deren ausdrückliche Verweigerung von Sinn und Ernst es ihnen ermöglicht, im spielerischen Kritzeln und Herumtippen auf der Schreibmaschine zu einer freien Sinnentfaltung zu kommen.
Jedenfalls machen diese kleinen Objekte Spaß, verströmen einen Geist von Freiheit, der den großen Leinwänden von Kerbach, Ebersbach oder Firit abgeht, die ebenso verkopft und verkrampft daher kommen wie die im selben Raum ausgestellten großen Schinken von Sitte.
Vielleicht gibt es ihn gar nicht, den Gegensatz zwischen Staatskünstlern und Widerständigen – die zeichenhafte, fast comicartig ruppige Malweise zum Beispiel, mit der Mattheuer den „Koloss II“ gestaltet, sie findet sich genauso in Günter Firits „Selbstzerstörung“.
Als ich durch die Ausstellung ging, musste ich zurückdenken an die Gemälde von Noah Davis, die ich vor kurzem in denselben Räumen gesehen habe, auch er ein Widerständiger. Als schwarzer US-Amerikaner malte er wütend gegen Rassismus und soziale Ungerechtigkeit an. Offenbar war es in seinem Land möglich, das klar auszudrücken und zur großen Form werden zu lassen. Bei den DDR-Künstlern der aktuellen Ausstellung des Minsk erlebte ich eher ein unwürdiges Versteckspiel, ein Verstecken hinter intellektuellen Formeln wie bei Mattheuer, hinter aufgesetztem Pathos wie bei Ebersbach und Sitte oder in einem nebulösen Irgendwo wie bei Händler.
Ich verließ die Ausstellung mit einem Gefühl von Kälte und Tristesse. War die DDR-Kunst wirklich so trostlos oder ist das dem persönlichen Geschmack und der Ankaufpolitik des Mäzens zu verdanken? Oder gar der Auswahl des Kurators Daniel Milnes aus Plattners doch umfangreicher Sammlung? Und wieso sammelt ein reicher Unternehmer aus dem Westen überhaupt mit solcher Ausdauer diese Kunst und errichtet ihr sogar ein eigenes Museum?
Vielleicht werden uns ja die kommenden Minsk-Ausstellungen unter der neuen Leitung Aufschluss darüber geben. Das könnte dann noch spannend werden.
... link (0 Kommentare) ... comment
Samstag, 1. Februar 2025
Dialog über Kunst
damals, 20:02h
"Weißt du", sag ich vorhin zu meiner Schwester, "die Leute haben mit Fluxus zu tun. Mag ich nicht so." - "Verstehe", antwortet sie, "so viel Kunststoff."
... link (6 Kommentare) ... comment
... older stories