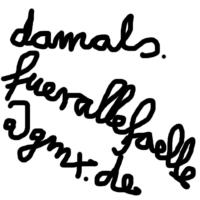Samstag, 12. April 2025
Ein Buch über Anna Seghers
damals, 13:03h
Das hat meine Frau billig irgendwo gekauft, und das interessierte mich auch, und so haben wir es gleichzeitig gelesen: über Anna Seghers’ Zeit nach 1945 in Berlin. Denn dass Anna Seghers, die großartige Schriftstellerin (ich kenne von ihr „Transit“, „Das siebte Kreuz“ und „Ausflug der toten Mädchen“), dann eine kreuzbrave Verfasserin stalinistischer Romane und Vorsitzende eines autoritär agierenden Schriftstellerverbands geworden sein soll, wie es die allgemeine Rede ist, daran kann ja irgendetwas nicht stimmen – oder wenn doch, dann müsste das doch spannend sein, „wie das möglich, ja, dass es überhaupt geschah“. (Morgenstern: Die unmögliche Tatsache)
Also zunächst die Fakten, die das Buch (Monika Melchert: Heimkehr in ein kaltes Land). Anna Seghers in Berlin) kenntnisreich und detailliert darstellt: Anna Seghers ist 1947 aus dem mexikanischen Exil nach Berlin zurückgegangen wie in eine Falle. Nachdem die Kinder 45/46 zum Studium nach Paris gegangen waren, stand auch für die Eltern die Rückkehr nach Europa an – Anna Seghers sollte nach Berlin vorangehen, ihr Mann wollte positivenfalls folgen. Was er dann aber nicht tat. Er blieb in Mexiko, wo er mit seiner Geliebten eine feste Bindung einging. Anna Seghers war in Berlin allein, wohnte zunächst im Westteil, behielt ihren mexikanischen Pass. Im selben Jahr traf sie ihre Freunde Brecht und Weigel in Paris, die auch erwogen, nach Ostberlin zu gehen. Brecht resümierte das Gespräch und den aktuellen Bericht seiner Freundin Seghers knapp, mit der Entscheidung, dass das nur mit ausländischem Pass denkbar ist. Seghers aber sich ließ von der Partei bequatschen und umwerben, tauschte die mexikanische gegen die DDR-Staatsbürgerschaft, zog nach Ostberlin und war ab da gefangen in ihrer Rolle als große kommunistische Schriftstellerin, die sie nun zu spielen hatte. Nun folgte auch ihr Mann, als er eine Professur für „Probleme des Imperialismus“ an der Humboldt-Uni bekam. Seine Geliebte brachte er mit, und er schrieb fleißig Denunziantenberichte für Partei und Stasi (wie er es schon in Mexiko für den sowjetischen Nachrichtendienst getan hatte) und er korrigierte – als Anna sich brav an die geforderten stalinistischen Romane machte – auch in ihre schriftstellerische Arbeit rein. Anna Seghers machte mit und hielt die Klappe. Später schrieb sie so gut wie gar nichts mehr.
So weit zum Inhalt des Buches.
Aber die Schreibweise: meine Güte! Also, zunächst mal fand ich verblüffend, wie unpolitisch oder politisch ahnungslos die Autorin über so ein hochpolitisches Thema schreibt. Zum Beispiel an der Stelle, wo sie Seghers` Probleme mit der Partei von 1947 thematisiert und dann meint, das sei auch 1951 noch nicht besser geworden. Noch nicht besser?! Jeder, der ein bisschen DDR-Geschichte kennt, und wenn er auch nur im Staatsbürgerkundeunterricht damals aufgepasst hat, der weiß doch, dass es 1951 natürlich schlimmer war als 1947. „Ja, das weißt du!“, meinte meine Frau, „aber die ist doch jung und weiß das nicht, das merkst du doch an ihrer ungelenken Schreibweise, manchmal wiederholt sich etwas, manchmal wirkt es ein bisschen naiv.“
Aber dann fielen mir doch Stellen auf, wo die Autorin schon zeigt, dass sie die politischen Zustände von damals kennt, nur wischt sie sie eben so im Nebensatz weg. Also googelte ich nach: Die Autorin ist keineswegs jung, sogar älter als ich, sie hat in den 70er Jahren in der DDR Germanistik studiert, promoviert und in Berlin als Literaturwissenschaftlerin gearbeitet. Eine rote Socke, die die Verhältnisse sehr gut kennt, nur nicht wahrhaben will. Und der Spruch, es sei 1951 „noch nicht“ besser geworden, nichts als eine Wiederholung der alten DDR-Lüge, alle Probleme der Gesellschaft hätten ihren Grund darin, dass der Sozialismus eben noch nicht so weit sei, wie er sein müsse, dass wir noch mehr an ihm und an uns arbeiten müssten blablabla.
Genauso im Privaten: Sie legt einen spießigen, kitschigen Feminismus an den Tag, der mehr vertuscht, als er aufklärt, der eigentlich ein Antifeminismus ist. „Also, mit Feminismus hat das nun gar nichts zu tun, wie die schreibt.“, protestierte meine Frau. Aber wie soll man das nennen? Bei ihr halten die Frauen immer zusammen und verstehen sich gut. Aber wovon sie reden, davon erfährt man nichts. Und es wird immer wieder betont, dass die Kinderaufzucht die Frauen so sehr belastet. Was aber mit den Männern ist, davon kein Wort. Die Männer werden durchweg als die „Liebsten“ ihrer Frauen bezeichnet. Das klingt zunächst ein bisschen süßlich, im Grunde aber verdeckt es die Art der jeweiligen Beziehung (Sind sie nun Ehemänner, Lebensgefährten, Geliebte oder was?). Es zeigt die Angst davor, irgendwas über die Struktur der jeweiligen Beziehung, über Verantwortlichkeiten, über strukturelle Diskriminierungen usw. auszusagen.
Und auch alles, was ich oben an „Fakten“ aufgeschrieben habe, sind natürlich schon meine Interpretationen des Gelesenen, die Autorin hätte das nie so klar ausgesprochen. Immer sich klein machen, das nette Mädchen von nebenan spielen und über jedes Problem bewusst hinwegsehen.
Das ist es, was mich immer wieder entsetzt, dieses Unerwachsene, gespielt Naive, Nett-Kitschige dieser roten Socken, dem unsereins immer wieder auf den Leim geht.
... und natürlich diese Rote-Socken-Taktik der Nachwendezeit, wo man ja nichts mehr leugnen kann: die jeweils schlimmsten Fakten eben so im Nebensatz zu erwähnen, ohne dass sie irgendwo Eingang in den Gedankengang finden, der rotsockig bleibt wie eh und je - für den Fall, dass einem jemand an den Wagen fährt, damit man sagen kann: Aber ich habs doch gesagt, ich habe es nicht verschwiegen.
Also zunächst die Fakten, die das Buch (Monika Melchert: Heimkehr in ein kaltes Land). Anna Seghers in Berlin) kenntnisreich und detailliert darstellt: Anna Seghers ist 1947 aus dem mexikanischen Exil nach Berlin zurückgegangen wie in eine Falle. Nachdem die Kinder 45/46 zum Studium nach Paris gegangen waren, stand auch für die Eltern die Rückkehr nach Europa an – Anna Seghers sollte nach Berlin vorangehen, ihr Mann wollte positivenfalls folgen. Was er dann aber nicht tat. Er blieb in Mexiko, wo er mit seiner Geliebten eine feste Bindung einging. Anna Seghers war in Berlin allein, wohnte zunächst im Westteil, behielt ihren mexikanischen Pass. Im selben Jahr traf sie ihre Freunde Brecht und Weigel in Paris, die auch erwogen, nach Ostberlin zu gehen. Brecht resümierte das Gespräch und den aktuellen Bericht seiner Freundin Seghers knapp, mit der Entscheidung, dass das nur mit ausländischem Pass denkbar ist. Seghers aber sich ließ von der Partei bequatschen und umwerben, tauschte die mexikanische gegen die DDR-Staatsbürgerschaft, zog nach Ostberlin und war ab da gefangen in ihrer Rolle als große kommunistische Schriftstellerin, die sie nun zu spielen hatte. Nun folgte auch ihr Mann, als er eine Professur für „Probleme des Imperialismus“ an der Humboldt-Uni bekam. Seine Geliebte brachte er mit, und er schrieb fleißig Denunziantenberichte für Partei und Stasi (wie er es schon in Mexiko für den sowjetischen Nachrichtendienst getan hatte) und er korrigierte – als Anna sich brav an die geforderten stalinistischen Romane machte – auch in ihre schriftstellerische Arbeit rein. Anna Seghers machte mit und hielt die Klappe. Später schrieb sie so gut wie gar nichts mehr.
So weit zum Inhalt des Buches.
Aber die Schreibweise: meine Güte! Also, zunächst mal fand ich verblüffend, wie unpolitisch oder politisch ahnungslos die Autorin über so ein hochpolitisches Thema schreibt. Zum Beispiel an der Stelle, wo sie Seghers` Probleme mit der Partei von 1947 thematisiert und dann meint, das sei auch 1951 noch nicht besser geworden. Noch nicht besser?! Jeder, der ein bisschen DDR-Geschichte kennt, und wenn er auch nur im Staatsbürgerkundeunterricht damals aufgepasst hat, der weiß doch, dass es 1951 natürlich schlimmer war als 1947. „Ja, das weißt du!“, meinte meine Frau, „aber die ist doch jung und weiß das nicht, das merkst du doch an ihrer ungelenken Schreibweise, manchmal wiederholt sich etwas, manchmal wirkt es ein bisschen naiv.“
Aber dann fielen mir doch Stellen auf, wo die Autorin schon zeigt, dass sie die politischen Zustände von damals kennt, nur wischt sie sie eben so im Nebensatz weg. Also googelte ich nach: Die Autorin ist keineswegs jung, sogar älter als ich, sie hat in den 70er Jahren in der DDR Germanistik studiert, promoviert und in Berlin als Literaturwissenschaftlerin gearbeitet. Eine rote Socke, die die Verhältnisse sehr gut kennt, nur nicht wahrhaben will. Und der Spruch, es sei 1951 „noch nicht“ besser geworden, nichts als eine Wiederholung der alten DDR-Lüge, alle Probleme der Gesellschaft hätten ihren Grund darin, dass der Sozialismus eben noch nicht so weit sei, wie er sein müsse, dass wir noch mehr an ihm und an uns arbeiten müssten blablabla.
Genauso im Privaten: Sie legt einen spießigen, kitschigen Feminismus an den Tag, der mehr vertuscht, als er aufklärt, der eigentlich ein Antifeminismus ist. „Also, mit Feminismus hat das nun gar nichts zu tun, wie die schreibt.“, protestierte meine Frau. Aber wie soll man das nennen? Bei ihr halten die Frauen immer zusammen und verstehen sich gut. Aber wovon sie reden, davon erfährt man nichts. Und es wird immer wieder betont, dass die Kinderaufzucht die Frauen so sehr belastet. Was aber mit den Männern ist, davon kein Wort. Die Männer werden durchweg als die „Liebsten“ ihrer Frauen bezeichnet. Das klingt zunächst ein bisschen süßlich, im Grunde aber verdeckt es die Art der jeweiligen Beziehung (Sind sie nun Ehemänner, Lebensgefährten, Geliebte oder was?). Es zeigt die Angst davor, irgendwas über die Struktur der jeweiligen Beziehung, über Verantwortlichkeiten, über strukturelle Diskriminierungen usw. auszusagen.
Und auch alles, was ich oben an „Fakten“ aufgeschrieben habe, sind natürlich schon meine Interpretationen des Gelesenen, die Autorin hätte das nie so klar ausgesprochen. Immer sich klein machen, das nette Mädchen von nebenan spielen und über jedes Problem bewusst hinwegsehen.
Das ist es, was mich immer wieder entsetzt, dieses Unerwachsene, gespielt Naive, Nett-Kitschige dieser roten Socken, dem unsereins immer wieder auf den Leim geht.
... und natürlich diese Rote-Socken-Taktik der Nachwendezeit, wo man ja nichts mehr leugnen kann: die jeweils schlimmsten Fakten eben so im Nebensatz zu erwähnen, ohne dass sie irgendwo Eingang in den Gedankengang finden, der rotsockig bleibt wie eh und je - für den Fall, dass einem jemand an den Wagen fährt, damit man sagen kann: Aber ich habs doch gesagt, ich habe es nicht verschwiegen.
... comment